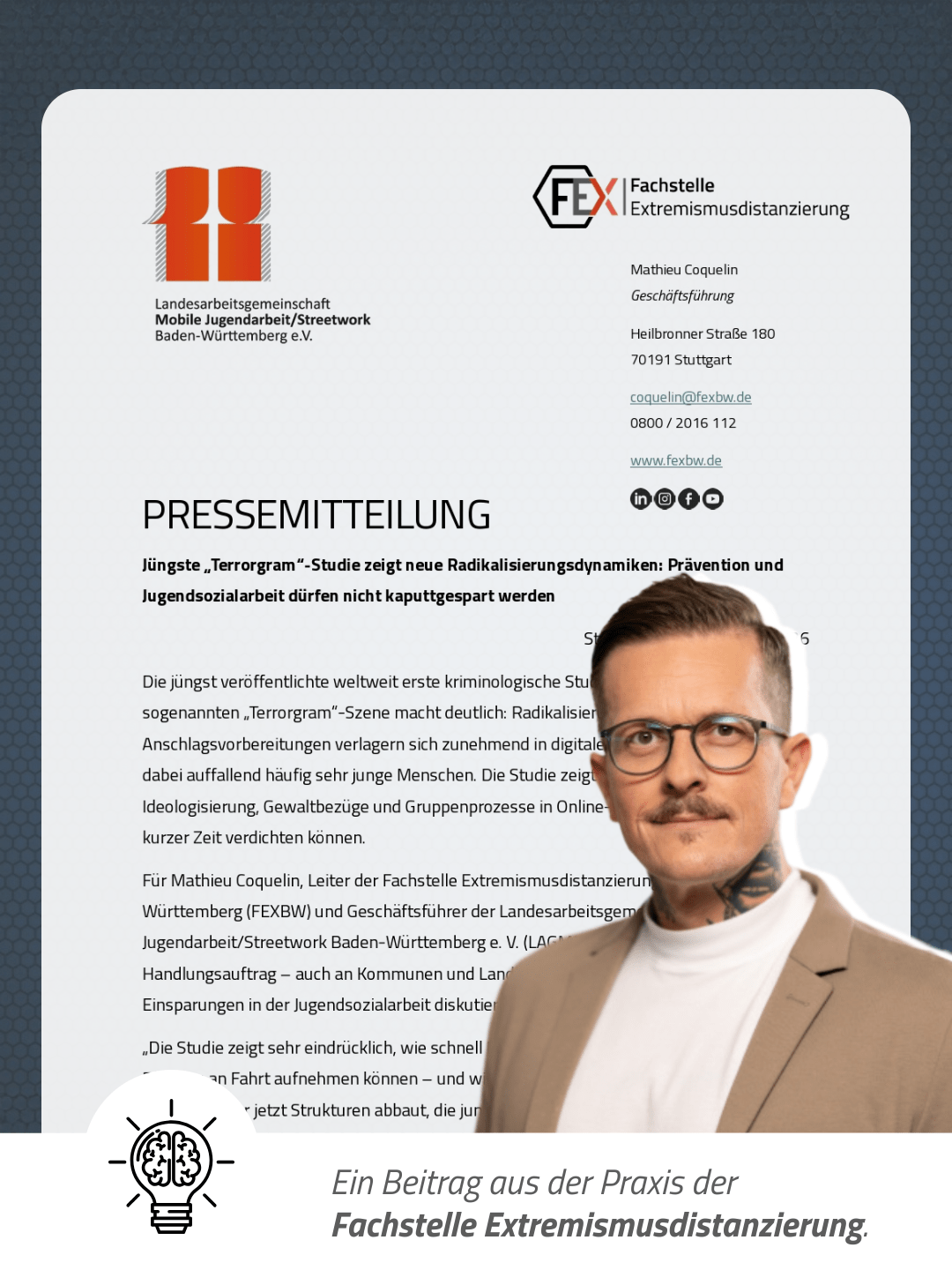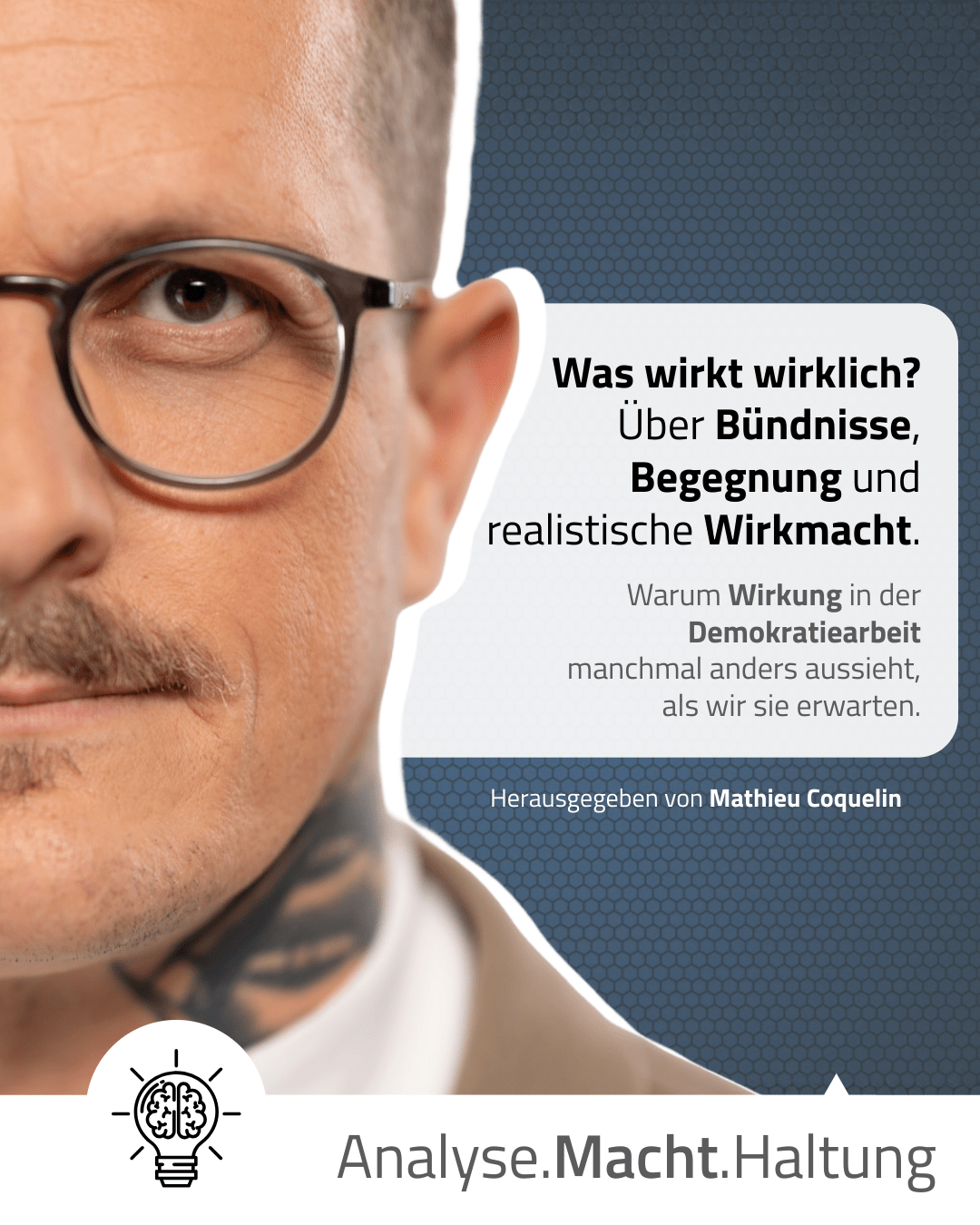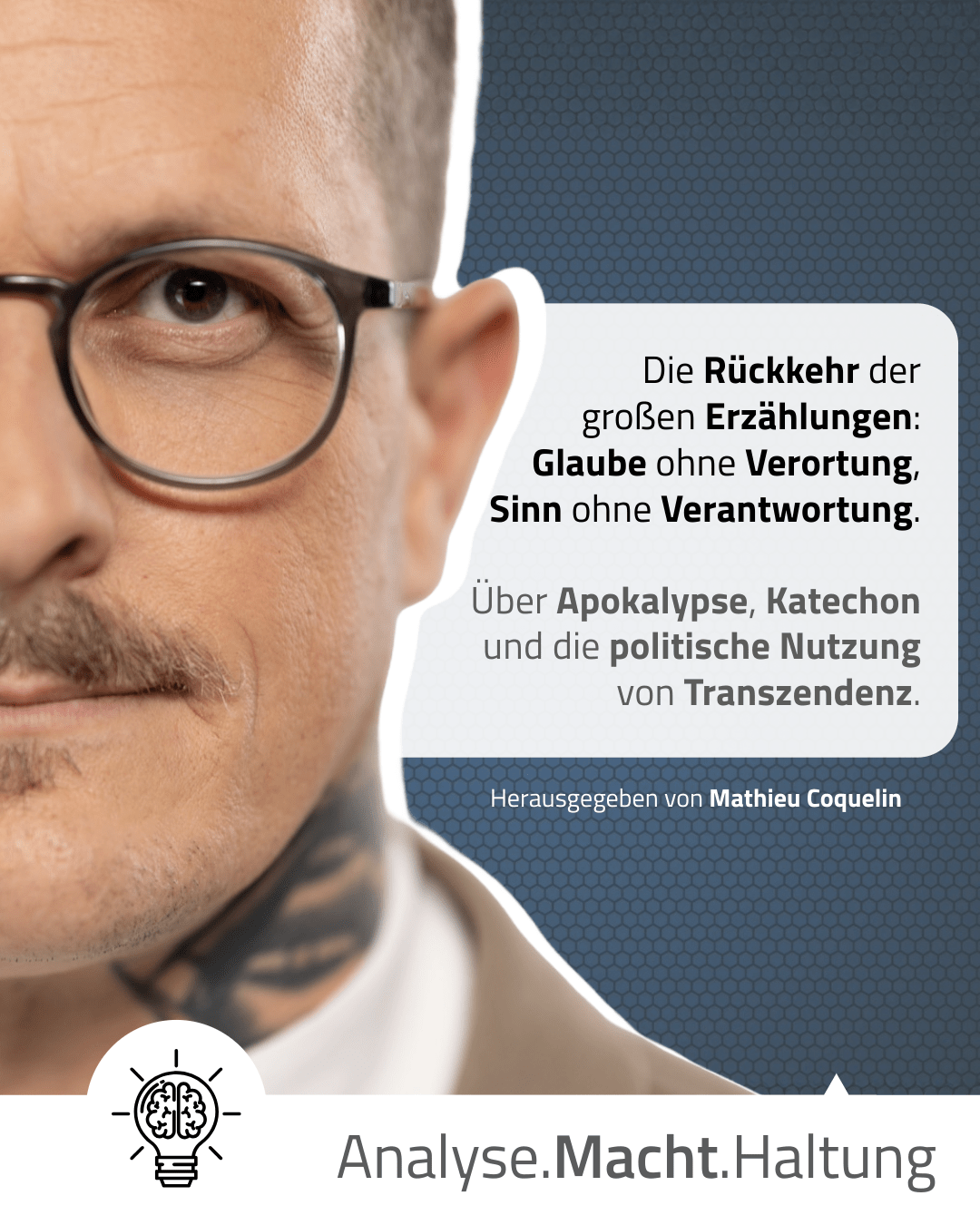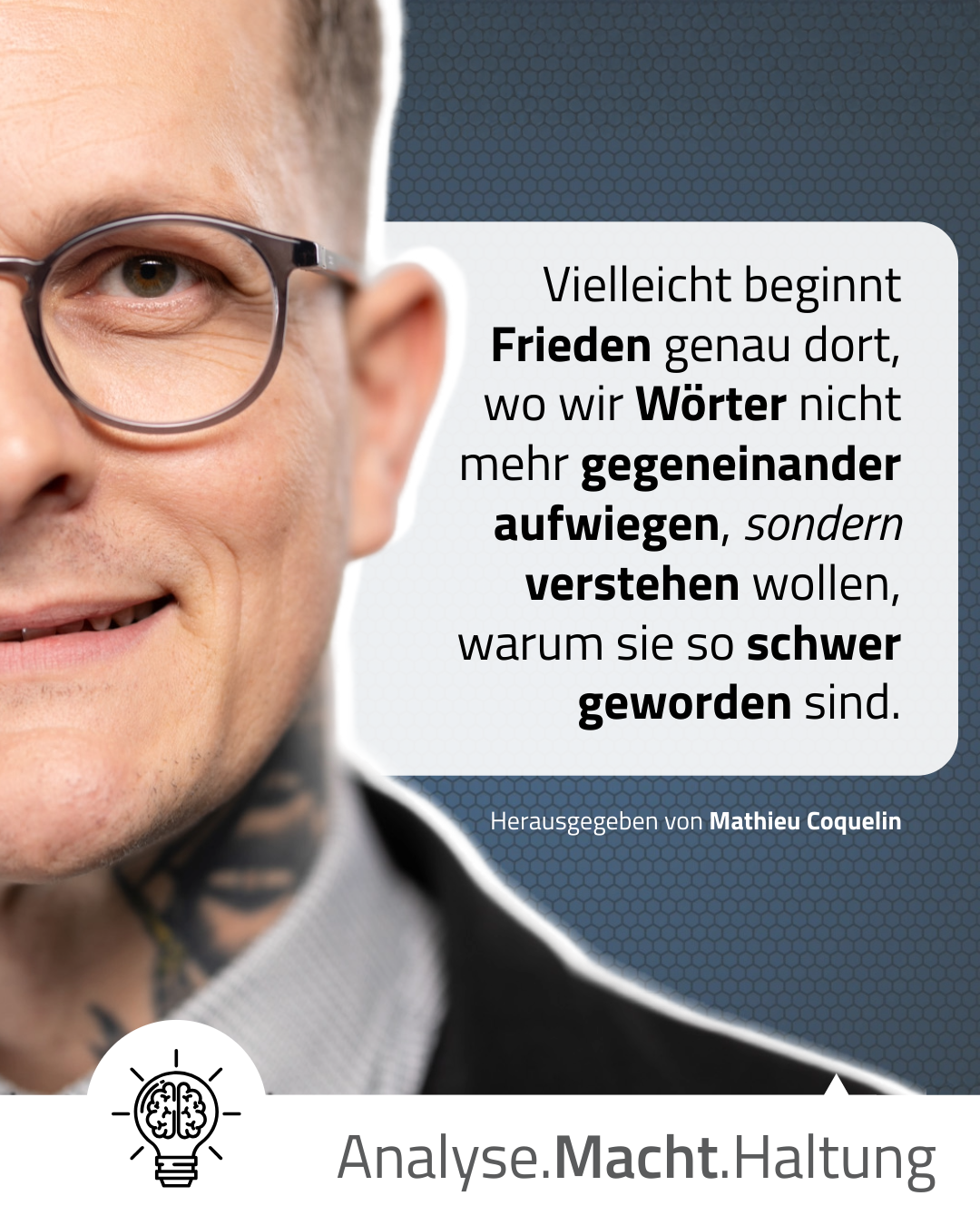
Die stille Lektion von Bad Wildbad – Über Sprache, Moral und die Kunst, Konflikte auszuhalten
Prolog – Ein Abend, der anders verlief
Ein paar Tage sind vergangen, seit ich in Bad Wildbad gesprochen habe – über antisemitische Narrative in sozialen Medien, im Rahmen einer Fachtagung zur Antisemitismusprävention. Ich habe seitdem oft an diesen Abend gedacht. Nicht, weil es Streit gab, sondern, weil er ruhig blieb.
Das Thema selbst war geladen.
Seit dem 7. Oktober 2023 wird kaum noch über Antisemitismus gesprochen, ohne dass der Nahostkonflikt sofort mitverhandelt wird. Fast immer taucht dann das Wort „Genozid“ auf – und mit ihm jene vertraute Spaltung: Oft kippt die Debatte, noch bevor sie beginnt.
Doch diesmal geschah das Gegenteil.
Als das Wort fiel, blieb der Raum still – nicht angespannt, sondern aufmerksam.
Ich habe erklärt, warum ich mich mit diesem Begriff schwertue: nicht aus juristischen Gründen, sondern, weil mich die Frage beschäftigt, wann Sprache selbst beginnt, Gewalt zu legitimieren. Aus meiner Perspektive, geprägt durch die deutsche Erinnerungskultur, ist „Genozid“ mehr als ein analytischer Begriff. Er ruft eine moralische Totalität auf, die Zwischentöne verschiebt.
Eine Teilnehmerin erwiderte, ruhig, fast tastend:
„Aber es gab doch andere Genozide auch.“
Und anstatt dass der Raum in Fronten zerfiel, blieb er offen. Wir redeten nicht über Wahrheit, sondern über Begründung. Nicht über Definition, sondern über Verstehen.
Rückblickend frage ich mich, warum das möglich war. Vielleicht, weil der Abend eine innere Ordnung hatte, die vorausging – eine gedankliche Architektur, in der Konflikt nicht als Gefahr, sondern als Gegenstand verstanden werden konnte.
Um das zu erklären, müssen wir dorthin zurück, wo dieser Abend begann: bei der Frage, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Extremismus, Radikalisierung und Gewalt sprechen – und warum manche sprachlichen Muster, wie in einem alten Video mit dem Titel „Der ewige Moslem“, auch nach zehn Jahren nicht verschwinden, sondern weiterwirken.
Erste Annäherung – Extremismus als notwendige Grenzziehung
Der Begriff in der Krise
Kaum ein Wort ist in der öffentlichen Debatte so präsent – und zugleich so entleert – wie Extremismus. Was einst eine präzise Kategorie war, ist heute ein schillernder Begriff geworden, der alles und nichts bedeuten kann. Man verwendet ihn, um Gegner zu markieren, nicht um Phänomene zu erklären.
Dieser Verlust an Schärfe hat Folgen.
Wenn jede Form radikaler Kritik oder politischer Leidenschaft als extremistisch gilt, verliert der Begriff seine Funktion: die Grenze zu markieren, jenseits der Demokratie endet.
Dann wird der Hinweis auf Extremismus nicht mehr als Warnung verstanden, sondern als Etikett, das man beliebig zurückweist.
Paradox: Wer ‚Extremismus‘ sagt, will differenzieren – und erzeugt doch Verwirrung.
Das Problem liegt nicht im Begriff selbst, sondern in seiner Verwendung.
Ein analytisches Instrument ist zu einem Kampfbegriff geworden.
Und wie alle Kampfbegriffe wirkt er stärker auf Personen als auf Ideen.
Darum ist es höchste Zeit, ihn zurückzuerobern – nicht als politisches Schlagwort,
sondern als Maßstab, der Orientierung gibt.
Definition und Kernproblem
Rechtlich ist die Linie klar: Die FDGO ruht auf drei Prinzipien – Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit (BVerfG 2017). Extremismus bedeutet in diesem Verständnis die aktive Feindschaft gegen diese Ordnung. Er richtet sich nicht gegen Regierungen oder einzelne Gesetze, sondern gegen das Fundament, auf dem demokratisches Zusammenleben ruht.
Doch genau hier liegt das Problem:
Viele Menschen wissen, wogegen Extremismus sich richtet – aber nicht, wofür die freiheitlich-demokratische Grundordnung steht.
Wenn die FDGO nur als abstraktes Konstrukt erscheint – ein Begriff aus Urteilen, Lehrbüchern, oder Paragrafen – dann bleibt sie fremd. Und eine Ordnung, die man nicht versteht, verteidigt man nicht.
Die FDGO als gelebte Erfahrung
Damit Demokratie mehr ist als ein Kapitel im Gemeinschaftskundeunterricht,
muss sie erfahrbar werden. Menschen lernen politische Ordnung nicht durch Definitionen,
sondern durch Begegnung – mit denjenigen, die sie verkörpern.
Lehrkräfte, Sozialarbeitende, Polizeibeamtinnen – sie alle sind Repräsentant:innen des Staates im Alltag. Durch sie wird erfahrbar, was Rechtsstaat heißt: zuhören, abwägen, gerecht handeln. Durch sie wird Demokratie sichtbar: Konflikte austragen, ohne den anderen zu entwürdigen. Und durch sie wird Menschenwürde spürbar: im Respekt vor der Vielfalt, im Schutz des Einzelnen.
In diesem Sinn ist politische Bildung kein Exkurs in Verfassungsgeschichte, sondern eine Übung im praktischen Staatsverständnis. Was zählt, ist erlebte Fairness – sie macht Rechtsstaat begreifbar. Extremismusprävention beginnt dort, wo junge Menschen erleben, dass Staat und Freiheit keine Gegensätze sind.
Die freiheitlich-demokratische Grundordnung wird nicht durch Zitate geschützt,
sondern durch Begegnungen, in denen sie spürbar wird.
Von der Grenze zur Bewegung
Wenn Extremismus die Haltung beschreibt, die sich gegen diese Ordnung richtet,
dann ist Radikalisierung der Weg dorthin – eine Bewegung, in der Vertrauen und Bindung zur FDGO verloren gehen.
So führt das Verständnis der Grenze unmittelbar zur Frage nach der Dynamik:
- Wie und warum verschiebt sich diese innere Linie?
- Wie wird aus Enttäuschung Distanz, aus Distanz Feindschaft?
Damit öffnet sich das nächste Kapitel – nicht mehr über die Ordnung, die wir verteidigen,
sondern über die Bewegung, die sich von ihr entfernt.
Zweite Annäherung – Radikalisierung als menschlicher Prozess
Radikalisierung ist Bewegung
Während Extremismus eine Position beschreibt, ist Radikalisierung ein Weg.
Sie bezeichnet den Prozess, in dem sich Menschen schrittweise von einem gemeinsamen Normrahmen entfernen – oft nicht aus Ablehnung, sondern aus Sinnsuche.
Radikalisierung ist damit kein Zustand, sondern eine Dynamik: Sie entsteht dort, wo das Bedürfnis nach Bedeutung, Zugehörigkeit oder Gerechtigkeit auf Resonanz trifft.
Diese Bewegung ist nicht automatisch extremistisch.
Sie kann sich in Engagement, Aktivismus oder auch in demokratischem Protest ausdrücken.
Erst dort, wo der Prozess den inneren „Toleranzpuffer“ verliert, wird aus Radikalität Gefahr.
Um dieses Spannungsfeld zu erklären, habe ich in meinen Fortbildungen ein Bild geprägt, das erstaunlich eingängig ist: den Schokokuchen.
Die Schokokuchen-Metapher
Man stelle sich einen Schokoladenfondant vor: außen eine stabile Hülle, innen ein flüssiger Kern. Der Kern steht für die Idee, an die jemand glaubt – religiös, politisch, moralisch.
Diese Idee ist zunächst unproblematisch. Sie wird erst dann gefährlich, wenn der äußere Teig, also der soziale Toleranzpuffer, zu dünn wird. Wenn das geschieht, tritt der heiße Kern nach außen. Dann wird aus Überzeugung Ausschluss, aus Leidenschaft Absolutheit.
Diese Metapher hilft, einen wichtigen Gedanken zu vermitteln: Ideen radikalisieren nicht von selbst – Menschen tun es. Und dieser Prozess ist von außen nur begrenzt sichtbar.
Wir können nicht in den Kern blicken, sondern nur an der Oberfläche erkennen, ob der Teig noch trägt.
Deshalb geht es in der Prävention weniger darum, Ideen zu kontrollieren, als soziale Bindung zu stabilisieren.
Das Borum-Modell im digitalen Zeitalter
Der US-Forscher Randy Borum beschrieb Radikalisierung bereits 2003 als vierstufigen Prozess:
Missstand → Ideologie → Mobilisierung → Engagement.
In der analogen Welt waren diese Phasen deutlich voneinander getrennt.
Doch im Zeitalter sozialer Medien verschwimmen sie.
Heute ist Mobilisierung selbst schon Engagement.
Ein Like, ein Post, ein Kommentar – sie alle sind Handlungen, die Resonanz erzeugen, Gruppen bilden, Zugehörigkeit stiften. Was früher Vorbereitung war, ist heute Teilnahme.
Damit sinkt die Schwelle zwischen Meinung und Handlung dramatisch.
Diese Entwicklung verändert auch den Blick auf Verantwortung. Digitale Kommunikation ist nicht nur Ausdruck, sondern Ereignis: Sie schafft Wirklichkeit, weil sie Handlungsfolgen hat.
Deshalb reicht es nicht, Radikalisierung als Bewusstseinsprozess zu verstehen – sie ist längst ein kommunikativer Vollzug.
Zwischen Beobachtung und Beziehung
Für die Präventionspraxis bedeutet das: Radikalisierung ist beobachtbar, aber nicht berechenbar. Sie lässt sich nicht an Checklisten erkennen, sondern nur im Kontext verstehen. Deshalb braucht Prävention Beziehung, keine Raster.
Wer Jugendlichen begegnet, die sich radikalisieren, braucht beides – Empathie und Analyse.
Empathie, um das Bedürfnis hinter der Haltung zu erkennen. Analyse, um zu verstehen, welche Dynamiken den Prozess tragen. In dieser Balance liegt die eigentliche Kunst: nicht zu moralisieren, aber auch nicht zu relativieren.
Radikalisierung zu verstehen heißt, Bewegung wahrzunehmen, bevor sie in Ideologie erstarrt.
Und doch dürfen wir dabei eines nicht vergessen: Unsere Wahrnehmung ist nie frei von Annahmen. Lehrkräfte, Sozialarbeitende, Fachkräfte – wir alle blicken auf junge Menschen durch eigene Deutungsmuster, geprägt von Erfahrung, Vorwissen, manchmal auch von Vorurteilen.
Was uns auffällt, hängt davon ab, was wir erwarten. Manche Kuchen halten wir für fest, obwohl sie längst zu heiß sind. Andere wirken instabil, obwohl sie in sich völlig ruhig bleiben.
Genau hier entfaltet die Schokokuchen-Metapher noch eine zweite Ebene:
Lehrkräfte haben in der Regel nicht einen Fondant vor sich, sondern 20 oder 30 kleine Törtchen – jedes mit eigener Füllung, eigenem Puffer, eigener Temperatur. Manche Kerne sind politisch, andere religiös, manche biografisch oder sozial. Manche Ideen sind heiß, aber ungefährlich; andere wirken kühl und sind doch brennbar. Wer all das begleiten will, braucht mehr als ein Standardrezept.
Darum funktionieren Workshops „für die ganze Klasse“ oft nur bedingt. Sie können Orientierung geben, aber keine Feinjustierung leisten. Prävention im schulischen Kontext heißt, diese individuelle Textur wahrzunehmen – und sich zugleich der eigenen Wahrnehmungsfilter bewusst zu werden. Denn jedes Urteil über den Zustand eines Kuchens hängt auch von der Temperatur des Ofens ab, in dem wir selbst stehen.
So verstanden ist die Metapher kein pädagogischer Gag, sondern eine Erinnerung an Demut:
Wir können nie in den Kern sehen – nur versuchen, den Raum so zu halten, dass nichts anbrennt. Beobachten statt labeln, widersprechen ohne Kränkung, Sprache entschleunigen
Dritte Annäherung – Gewalt als gedeutete Notwendigkeit
Gewalt als Narrativ, nicht als Ausnahme
In der öffentlichen Wahrnehmung erscheint Gewalt meist als Zäsur – als plötzlicher Bruch, als Handlungsabirrung, als Ausnahme. Doch wer sich länger mit Radikalisierungsprozessen beschäftigt, erkennt schnell: Gewalt ist selten der Anfang. Sie ist das Ende einer Geschichte, die lange vorher beginnt – in Sprache, Bildern, Vergleichen, Zuschreibungen.
Der Sozialpsychologe Randy Borum hat diesen Zusammenhang früh beschrieben. In seinem zweiten Modell, dem sogenannten Terrorist Mindset, geht er davon aus, dass Gewalt nicht entsteht, weil Menschen „plötzlich gefährlich werden“, sondern weil sie lernen, Gewalt als notwendig zu begreifen. Dieser Lernprozess ist kein pathologischer Ausbruch, sondern ein moralischer Umbau.
Im Zentrum steht dabei ein Perspektivwechsel: Zunächst gibt es einen Missstand – etwas, das als Unrecht erlebt wird. Dann entsteht die Überzeugung, dass dieses Unrecht systematisch und absichtsvoll verursacht ist. Das verwandelt Missstand in Ungerechtigkeit.
Wenn sich dieser Gedanke verfestigt, folgt der nächste Schritt: die Suche nach Verantwortlichen, nach Schuldigen, nach „denen“. Ihnen wird Handlungsmacht zugeschrieben – und damit entsteht das Gefühl, selbst handeln zu müssen. Gewalt erscheint plötzlich nicht mehr als Aggression, sondern als moralische Pflicht.
Diese Dynamik findet sich in ganz unterschiedlichen Kontexten: in politischem Aktivismus, in religiöser Radikalisierung, in Verschwörungsnarrativen oder in digitaler Mobilisierung. Immer geht es um dieselbe Verschiebung: Die eigene Handlung wird als Wiedergutmachung verstanden – nicht als Angriff. Gewalt wird legitim, weil sie in eine moralische Logik eingebettet ist.
Gerade in sozialen Medien lassen sich diese Prozesse heute nahezu in Echtzeit beobachten. Dort, wo Empörung algorithmisch verstärkt wird, verwandelt sich Sprache in Handlung. Worte wie „Kampf“, „Verrat“ oder „Rache“ werden zum moralischen Code, der Zustimmung kanalisiert.
Der Diskurs erzeugt eine emotionale Temperatur, in der Gewalt plausibel wirkt – nicht, weil sie gefordert, sondern weil sie gefühlt gerechtfertigt erscheint.
Die Mechanismen der Legitimation
Borum beschreibt vier zentrale Mechanismen, die diesen Übergang von Denken zu Handeln strukturieren:
Missstand, Ungerechtigkeit, Zuschreibung, Entmenschlichung.
Sie wirken wie eine innere Dramaturgie, die den moralischen Rahmen verschiebt.
- Missstand: Am Anfang steht die Erfahrung, dass etwas nicht stimmt – ein Gefühl der Benachteiligung oder des Ausschlusses.
Diese Wahrnehmung ist häufig real und nicht ideologisch gefärbt.
Sie wird erst dann brisant, wenn sie als kollektiv geteilt erlebt wird. - Ungerechtigkeit: Aus dem Missstand wird eine moralische Kategorie.
Die Emotion kippt von Frustration in Empörung.
Ungerechtigkeit erzeugt Handlungsdruck – sie verlangt Antwort. - Zuschreibung: Nun braucht das Unrecht ein Gesicht.
Verantwortung wird externalisiert: „Die da oben“, „die Medien“, „die Ungläubigen“, „die Zionisten“.
So entsteht ein „Wir“ gegen „Sie“. - Entmenschlichung: Der letzte Schritt vollzieht sich sprachlich.
Wenn Gegner nicht mehr als Menschen, sondern als Symbole gelten, wird Gewalt möglich, ohne dass sie als solche empfunden wird.
Sie erscheint als Reinigung, Verteidigung oder Notwehr.
Diese Mechanismen greifen nicht nur in Extremismuskontexten, sondern auch in alltäglichen Diskursen. Wir finden sie in Kommentarspalten, in politischen Talkshows, manchmal sogar in Klassenzimmern. Sprache wird dort zur Bühne, auf der Gewalt normalisiert wird – oft, ohne dass jemand sie explizit fordert.
Das Fatale: Wer in solchen Logiken argumentiert, glaubt meist, moralisch zu handeln. Das unterscheidet Gewaltlegitimation von bloßer Aggression. Sie beruht nicht auf Kälte, sondern auf Überzeugung. Und genau deshalb ist sie pädagogisch so schwer zu fassen.
Hier schließt sich der Kreis zum Ausgangspunkt des Vortrags: Wenn wir über Antisemitismus in sozialen Medien sprechen, begegnen wir denselben Mustern. Nur dass sie dort in Bildern, Hashtags und Vergleichen auftreten. Wer verstehen will, warum Debatten über den Nahostkonflikt so schnell eskalieren, muss diese sprachlichen Mechanismen der Legitimation erkennen.
Das führt unmittelbar in das nächste Kapitel – dorthin, wo Sprache selbst zum Gegenstand wird: zur Sprachfalle, die aus Empörung Legitimation formt.
Zwischen Missstand und Ungerechtigkeit – wenn die Modelle sich berühren
Um zu zeigen, wie eng die beiden Modelle von Randy Borum miteinander verwoben sind, nutze ich in Seminaren häufig ein Beispiel, das zunächst harmlos klingt: die ungleiche Behandlung von Frauen.
Fast alle können sich spontan auf den ersten Schritt des Modells einigen: Ja, es gibt einen Missstand – ungleiche Bezahlung, geringere Sichtbarkeit, eingeschränkte Aufstiegschancen.
Diese Feststellung ist sachlich, oft sogar empirisch untermauert. Doch spannend wird es, wenn ich im zweiten Schritt frage:
„Für wen wird daraus Ungerechtigkeit – also etwas, das zum Handeln zwingt?“
Dann melden sich in aller Regel zuerst Frauen. Sie erleben den Missstand als Ungerechtigkeit, weil sie ihn unmittelbar betrifft.
Für andere bleibt er abstrakt, solange keine persönliche Betroffenheit entsteht. Hier zeigt sich der entscheidende Übergang: Nicht das Faktische verändert sich, sondern die Deutung des Faktischen. Aus Wahrnehmung wird Moral, aus Beschreibung Verpflichtung.
Genau an diesem Punkt berühren sich die beiden Borum-Modelle: Das erste erklärt, wie Menschen auf einen Missstand reagieren und sich radikalisieren – das zweite, wie sie diesen Prozess innerlich legitimieren. Der Moment der moralischen Aufladung verbindet beide. Er verschiebt das Denken vom „Es gibt ein Problem“ hin zu „Ich muss etwas tun“.
In der Praxis zeigt sich das in unzähligen Varianten – von der Klima-Aktivistin, die zivile Ungehorsam als moralische Pflicht versteht, bis zum religiösen Eiferer, der Gewalt als göttlichen Auftrag begreift. Der Mechanismus ist identisch, nur die Inhalte unterscheiden sich.
Gerade deshalb ist dieses Beispiel so wirksam: Es macht deutlich, dass moralische Motivation und Gewaltpotenzial nicht gegeneinander stehen, sondern auf derselben Achse liegen. Ob aus moralischem Engagement ein destruktiver Impuls wird, entscheidet sich daran, ob Menschen noch erleben, dass andere Perspektiven möglich sind.
Wenn dieser Resonanzraum verschwindet, wenn moralische Gewissheit sich in Isolation verwandelt, dann kippt der Prozess – und aus Radikalisierung wird Legitimation von Gewalt. Insofern erklärt dieses kleine Beispiel eine große Dynamik:
Gewalt entsteht nicht, weil Menschen Unrecht empfinden,
sondern weil sie glauben, allein zu wissen, was Gerechtigkeit verlangt.
Die Sprachfalle – Wenn Worte Wirklichkeiten verschieben
Der Begriff „Genozid“ als moralischer Trigger
Worte tragen Gewicht – besonders dann, wenn sie geschichtsträchtig sind. Kaum ein Begriff bündelt in Deutschland mehr moralische Bedeutung als Genozid. Er ruft nicht nur Fakten auf, sondern Erinnerungen, Schuld, Verantwortung. Er ist nicht neutral – er ist emotional codiert.
Seit dem 7. Oktober 2023 taucht dieses Wort in fast jeder Diskussion über Antisemitismus und Nahost auf. Es scheint unmöglich, über den Konflikt zu sprechen, ohne dass irgendwann die Frage fällt:
„Ist das nicht ein Genozid?“
In Bad Wildbad kam sie ganz am Ende meines Vortrags. Ich habe mich klar positioniert – nicht, weil ich eine juristische Wertung abgeben wollte, sondern, weil mich die Frage beschäftigt, wann Sprache selbst beginnt, Gewalt zu legitimieren.
Denn wer einen Konflikt in den Begriff „Genozid“ fasst, setzt ihn in einen moralischen Rahmen, aus dem es kaum noch ein Zurück gibt. Genozid ist der Name für das größte denkbare Verbrechen. Er trägt in Deutschland immer den Nachhall des Holocaust in sich – und damit die Erwartung, dass wer so etwas benennt, auch entsprechend handeln muss.
Das ist die Sprachfalle: Ein Wort wird zur moralischen Handlungsanweisung. Sein Gebrauch löst nicht nur Empathie, sondern Dringlichkeit aus. Und wer sich diesem Impuls entzieht, wirkt wie jemand, der weggesehen hat.
In diesem Sinne ist „Genozid“ kein analytischer Begriff mehr, sondern ein semantischer Schalter – er kippt Gespräche von der Beschreibung in die Verurteilung. Selbst dort, wo die Absicht nur moralische Klarheit war, entsteht ein Raum, in dem jede Abweichung vom Begriff als Relativierung gelesen wird.
Empörung, Moral und die Rhetorik der Totalität
Diese Dynamik zeigt, wie stark Sprache Handlungsräume formt. Begriffe wie „Genozid“, „Apartheid“ oder „Kreuzzug“ sind nicht nur Beschreibungen – sie sind Rahmungen. Sie übersetzen komplexe Sachverhalte in moralische Eindeutigkeit. Und sie haben eine gemeinsame Funktion: Sie verkürzen Ambivalenz, um Entscheidung zu erzwingen.
Im Borum-Schema wäre das der Moment, in dem aus Ungerechtigkeit Pflicht wird. Die Worte selbst werden zum Auslöser dieser moralischen Verschiebung. Sie erlauben, Leid nicht mehr zu verstehen, sondern nur noch zu bewerten.
Gerade in Debatten über Antisemitismus wird dies deutlich. Wer von Genozid spricht, meint vielleicht Solidarität – er schafft aber eine semantische Welt, in der Gewalt gegen die angeblich Schuldigen als moralisch vorstellbar wird. Das geschieht nicht explizit, sondern implizit – durch die Logik des Vergleichs.
Denn wer einen aktuellen Konflikt in die Sprache des Holocausts übersetzt, ruft nicht nur Mitgefühl auf, sondern auch den Reflex der Erinnerungsverantwortung. Er ruft jene Erzählung auf, in der Zuschauen schuldhaft ist und Nicht-Handeln kompromittiert. Damit entsteht – ungewollt – ein moralisches Drehbuch, in dem Widerstand zur Pflicht wird.
Diese Mechanismen lassen sich auch in sozialen Medien beobachten. Hashtags wie #NeverAgain oder #FreePalestine tragen unterschiedliche Anliegen, aber eine gemeinsame Struktur: Sie rufen eine absolute Moral auf. In diesen Räumen geht es nicht mehr um Diskussion, sondern um Positionierung. Sprache wird zur Identitätsmarke – und damit zum Grenzsignal.
Das war in Bad Wildbad anders.
Die Diskussion blieb ruhig, weil der Begriff nicht mehr als moralischer Endpunkt, sondern als Sprachphänomen behandelt wurde. Wir sprachen nicht darüber, ob etwas ein Genozid ist, sondern darüber, was mit uns passiert, wenn wir das Wort benutzen.
Vielleicht war das die entscheidende Verschiebung: Der Diskurs über Gewalt wurde selbst zum Gegenstand der Reflexion. Und damit hörte er auf, gewalttätig zu sein.
Fallbeispiel: „Der ewige Moslem“ – ein Narrativ, das bleibt
Das Video „Der ewige Moslem“ von Generation Islam erschien vor über zehn Jahren – und ist heute noch auf TikTok, Instagram und YouTube im Umlauf, oft leicht verändert oder neu geschnitten. Seine Langlebigkeit ist kein Zufall. Sie zeigt, wie wirkungsvoll Sprache als Träger von Weltbildern sein kann.
Das Video folgt einer einfachen Dramaturgie: Es beginnt mit realen Erfahrungen von Ausgrenzung – Diskriminierung, Stereotypisierung, dem Gefühl, nicht dazuzugehören. Diese Missstände sind nicht erfunden, sondern emotional anschlussfähig. Doch im Verlauf kippt der Ton. Aus Erfahrung wird Erzählung, aus Beobachtung wird Beweis. Die Botschaft lautet: Der Moslem sei der neue Jude – verfolgt, missverstanden, bedroht.
Damit entsteht eine Analogie der Opferrolle, die reale Ungerechtigkeit in eine moralische Gesamterklärung verwandelt: Die Welt ist gegen uns – und wir sind im Recht, uns zu wehren. Gerade diese Rhetorik macht das Video so gefährlich und zugleich so beständig.
Es bietet Zugehörigkeit, erklärt Komplexität – und liefert ein Gefühl von moralischer Reinheit.
Das Narrativ funktioniert, weil es gleichzeitig Empathie weckt und Verantwortung verschiebt: Diejenigen, die kritisieren, erscheinen als Täter; die eigene Gruppe wird zur letzten Instanz von Wahrheit.
Dass dieses Stück Medienrhetorik über ein Jahrzehnt hinweg kursiert, ist aufschlussreich.
Es zeigt, dass Legitimationsmuster langlebiger sind als ihre Formate. Selbst wenn die Bilder altern, bleibt die Sprache wirksam: Sie rahmt Missstand als Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit als Angriff – und Angriff als Notwehr.
Für die Prävention heißt das: Wer verstehen will, warum bestimmte Narrative überdauern,
muss weniger fragen, was sie behaupten, als wie sie sprechen. Denn in der Art, wie Worte Bedeutung ordnen, liegt oft schon der Keim der Legitimation.
Der stille Lerneffekt – Eine Erfahrung von Verstehen
Konfliktfreiheit ohne Konsens
Im Rückblick erscheint mir dieser Abend nicht als Erfolg, weil niemand widersprochen hätte – sondern, weil Widerspruch möglich, aber nicht nötig war. Wir hatten nicht das Bedürfnis, uns zu einigen. Wir wollten verstehen.
Das ist selten geworden.
In vielen Debatten ersetzt Konsens inzwischen das Nachdenken. Man einigt sich schneller, als man begreift – oder zieht sich zurück, sobald Einigung nicht in Sicht ist. Doch an diesem Abend geschah etwas anderes: Die Spannung blieb, aber sie blieb erträglich.
Vielleicht lag das daran, dass es keine moralischen Sieger oder Verlierer gab. Niemand musste seine Haltung verteidigen, niemand die eigene Identität schützen. Der Diskurs selbst war das Ziel – nicht seine Auflösung.
In dieser Atmosphäre wurde deutlich, was in der Präventionsarbeit oft schwer zu greifen ist: Nicht jedes ruhige Gespräch ist ein Kompromiss, aber jedes ehrliche Gespräch ist Prävention. Denn Prävention beginnt dort, wo Konflikte besprechbar bleiben.
Prävention als hermeneutische Praxis
Prävention wird oft als Reaktion verstanden – als Intervention, als Programm, als Kontrolle. Doch sie kann auch eine hermeneutische Praxis sein: das geduldige Lesen der Welt, bevor sie sich zuspitzt. Sie fragt nicht: Wie stoppen wir Gewalt?, sondern: Wie verstehen wir, wann sie beginnt, sich zu rechtfertigen?
In Bad Wildbad zeigte sich, dass Verstehen nicht passiv ist. Es ist eine Form des Widerstands – gegen Simplifizierung, gegen moralische Automatismen, gegen die Versuchung, jedes Urteil in Freund und Feind zu teilen. Verstehen bedeutet, das Deuten zu üben, bevor die Deutung Gewalt wird.
Das erfordert Zeit, Aufmerksamkeit und ein Bewusstsein dafür, dass jede Interpretation eine Verantwortung trägt. Denn Deutung ist nie neutral – sie formt Realität. Wer das anerkennt, behandelt Sprache nicht als Waffe, sondern als Werkzeug.
Und vielleicht ist das der stillste, aber wirksamste Beitrag, den Bildung leisten kann:
nicht Frieden zu lehren, sondern Friedfertigkeit im Denken.
Differenzierung als Akt der Friedfertigkeit
Gegen die Ökonomie der Empörung
Wir leben in einer Zeit, in der Eindeutigkeit belohnt wird. Soziale Medien, politische Talkshows, öffentliche Debatten – sie alle bevorzugen das schnelle Urteil, den klaren Gegensatz, den kurzen Weg zur Empörung. Differenzierung dagegen wirkt sperrig. Sie braucht Geduld, Kontext, Verantwortung. Sie ist anstrengend – und deshalb selten quotentauglich.
Doch wer Prävention als Bildungsaufgabe begreift, weiß: Empörung ist ein kurzer Weg – Verstehen ist ein langer. Und dieser lange Weg ist es, der Demokratie trägt.
Denn Demokratie entsteht nicht aus Einigkeit, sondern aus der Fähigkeit, Unterschiede auszuhalten, ohne sie in Feindschaft zu übersetzen.
Differenzierung ist also keine intellektuelle Zierde, sondern eine Form von Zivilität. Sie verlangt Mut zur Langsamkeit und die Bereitschaft, Widerspruch nicht als Bedrohung, sondern als Resonanz zu lesen. Wer differenziert, verweigert sich der Logik der Empörung – und praktiziert damit bereits Widerstand.
Sprache als Ethik des Miteinanders
Vielleicht ist das die stille Lehre aus diesem Abend in Bad Wildbad:
Dass Sprache nicht nur Medium von Wahrheit ist, sondern auch eine Form von Haltung. Wer sich um Worte müht, müht sich um Menschen. Und wer Begriffe trennt, bewahrt Beziehungen.
Prävention beginnt nicht bei der Tat, sondern im Denken über das Denken. In der Fähigkeit, Begriffe zu sortieren, bevor sie zu Schlagwörtern werden. In der Bereitschaft, Sprache nicht als Grenze, sondern als gemeinsamen Raum zu begreifen.
Vielleicht beginnt Frieden genau dort – wo wir Wörter nicht mehr gegeneinander aufwiegen,
sondern verstehen wollen, warum sie so schwer geworden sind.