
Warum Sprache entscheidet, welche Zukunft wir sehen – Ein Essay zum 1. Advent
Advent als Moment des Innehaltens
Der erste Advent hat etwas Beruhigendes. Die Wochen davor waren voll, politisch wie gesellschaftlich. Und gerade deshalb fühlt sich dieser Moment wie eine kleine Atempause an. Eine Einladung, einmal Abstand zu nehmen von all den aufgeregten Schlagzeilen und zu schauen, wie wir eigentlich über unsere gemeinsamen Probleme sprechen.
Mir ging in den letzten Tagen ein Gedanke nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe ein Interview mit dem Politikberater Johannes Hillje gehört. Er beschreibt eine Entwicklung, die viele spüren: dass sich politische Debatten zu sehr um destruktive Kräfte drehen, statt um die Lösungen, die wir eigentlich brauchen. Dass Politik – und am Ende auch Gesellschaft – oft nur noch gegen etwas spricht, statt für etwas.
Dieser Gedanke hat mich getroffen. Denn er erklärt, warum manche Debatten sich seltsam leer anfühlen, obwohl unzählige Menschen sich ernsthaft bemühen, differenziert zu argumentieren. Vielleicht liegt es daran, dass wir schon am Startpunkt in eine Richtung laufen, die gar nicht unsere ist.
Und genau darüber möchte ich heute, zum ersten Advent, nachdenken.
Warum unsere politische Kommunikation so schnell kippt
Wenn man den politischen Diskurs der letzten Zeit betrachtet, fällt ein Muster auf. Immer häufiger reden wir über Probleme, indem wir über jene sprechen, von denen wir glauben, dass sie die Probleme „verursachen“. Wir reden über Akteur:innen, über Gruppen, über Stimmungen. Aber erstaunlich selten über die praktischen Wege, wie wir Probleme tatsächlich lösen können.
Die politische Kommunikation folgt dabei oft einer Negativlogik. Sie beschreibt Krisen über Problemträger – nicht über Handlungsspielräume. Und das hat Konsequenzen. Denn wer dauerhaft nur reagiert, überlässt anderen Platz für die Definition dessen, worüber gesprochen wird.
Hillje hat diesen Mechanismus sehr klar beschrieben: Wenn politische und mediale Kommunikation bestimmte Kräfte ständig mitdenkt, sogar dann, wenn man sie gar nicht zum Thema machen möchte, verschiebt sich der gesamte Diskurs. Es entsteht der Eindruck, Politik beschäftige sich fast ausschließlich mit Abwehr, statt mit Gestaltung.
Hier kommt ein zweiter Mechanismus hinzu, den wir selten offen ansprechen:
Wenn eine politische Kraft ein Problem nicht nur benennt, sondern gleich eine – wenn auch radikale – Lösung anbietet, entsteht eine Asymmetrie.
Denn viele andere Akteur:innen sprechen zwar ebenfalls über das Problem, aber sie kommunizieren keine konkreten Lösungswege oder bleiben im Ankündigungsmodus.
So entsteht eine paradoxe Lage:
- Die einen liefern eine – demokratisch nicht akzeptable – „Antwort“.
- Die anderen beschreiben vor allem das Problem.
Und wer nur das Problem hört, aber keine Alternativen, gewinnt leicht den Eindruck, nur eine einzige Seite habe eine klare Vorstellung davon, wie man handeln könnte.
Das ist kein Argument für diese Lösung, aber ein Kommunikationsvakuum für alle anderen. Es erklärt allerdings, warum sich Debatten so schnell in Richtungen bewegen, die nicht gewollt sind.
Und genau deshalb ist es so wichtig, sich anzuschauen, wie Begriffe, Deutungsräume und sprachliche Setzungen überhaupt entstehen – und was sie auslösen können.
Beispiel Stadtbild-Debatte – ein Lehrstück in Deutungsräumen
Vor ein paar Monaten lief eine Debatte, in die ich mich ganz bewusst nicht eingemischt habe. Nicht, weil mir das Thema egal wäre. Im Gegenteil. Aber weil ich das Gefühl hatte, dass diese Diskussion schon in ihrem ersten Moment auf eine Schiene gesetzt wurde, die kaum jemand wirklich verlassen konnte.
Der Begriff, um den es ging, war „Stadtbild“. Ein Begriff, der auch in anderen Zeiten kaum präziser gewesen wäre. Und egal, wie er am Ende gemeint war – offen, breit, unspezifisch – er konnte vieles erfassen: die Gestaltung öffentlicher Räume, den Zustand von Straßen und Schulen, Fragen von Infrastruktur, Entwicklung oder Leerstand. Viele Beiträge haben genau das später versucht zu betonen, differenziert und fachlich legitim.
Und trotzdem blieb der Eindruck, dass die Diskussion von Anfang an in einen Deutungsraum rutschte, der nicht allen bewusst war. Nicht zwingend, weil ihn jemand absichtlich öffnen wollte. Sondern weil Sprache manchmal eigene Wege nimmt.
Begriffe prägen, welche Wirklichkeiten sichtbar werden.
Und manche Begriffe – besonders die vagen – öffnen Räume, die sich kaum wieder schließen lassen.
Diskursverschiebung im Zeitverlauf: Warum Sprache nicht mehr im leeren Raum wirkt
Um zu verstehen, warum manche Begriffe heute so schnell kippen, muss man sich anschauen, in welchem sprachlichen Umfeld sie auftauchen. Denn Debatten entstehen nie isoliert. Sie setzen sich auf bereits bestehende Deutungsräume, Muster und Stimmungen drauf.
Lange bevor die Stadtbilddebatte begann, hatte ein anderer Begriff enorme öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt: „Remigration“. Ein Wort, das eindeutig aus dem Rechtsextremismus stammt – und dessen ursprüngliche Bedeutung nie harmlos gemeint war. Doch im Laufe der Zeit wurde der Begriff so verwendet, dass er plötzlich zwei Ebenen gleichzeitig tragen konnte: eine radikale Bedeutung und eine scheinbar administrative, die so tat, als ginge es um nüchterne Steuerung.
Diese Doppelbödigkeit hat etwas verändert.
Sie hat den Sprachraum geöffnet – nicht inhaltlich, aber atmosphärisch. Sie hat gezeigt, dass extreme Begriffe inzwischen in einem breiteren gesellschaftlichen Spektrum diskutiert werden und dass sie sich festsetzen können, auf eine Weise, die vor Jahren kaum denkbar gewesen wäre.
Vor diesem Hintergrund bekam auch die Stadtbilddebatte einen anderen Klang.
Nicht, weil der Begriff bewusst mit extremistischen Narrativen verknüpft worden wäre. Sondern weil er unmittelbar im Kontext einer Aussage zu Migration und Asylzahlen gefallen ist – also genau jenem Themenfeld, auf dem kurz zuvor versucht worden war, den Begriff „Remigration“ in den gesellschaftlichen Diskurs zu schieben. Beide Debatten adressierten, wenn auch aus völlig unterschiedlichen politischen Positionen, dieselbe Problemachse. Und es entstehen Verbindungen, die niemand gesetzt hat, die aber doch im Raum stehen.
Eine vage Formulierung wie „Stadtbild“ fällt damit heute nicht mehr in einen neutralen Diskurs.
Vor 20 oder 30 Jahren wäre eine Stadtbilddebatte vermutlich eine rein konservative oder kommunalpolitische Diskussion gewesen. Vielleicht wäre sie innerhalb einer Union verortet geblieben, als klassisches Ordnungsthema, und ob sie damals klug gewesen wäre, möchte ich hier und heute nicht beurteilen.
Aber heute existiert ein zusätzlicher Akteur, der solche Begriffe für sich nutzen kann – indem er sie mit eigenen Deutungsmustern auflädt, die längst vertraut wirken, weil sie vorher schon in den Diskurs eingespeist wurden.
Das ist der eigentliche Punkt: Nicht die Stadtbilddebatte an sich ist das Problem. Sondern die Frage, in welchem sprachlichen Klima sie geführt wird.
Warum klare Problembenennung wichtig ist – und warum Sprache trotzdem sorgsam bleiben muss
Wenn ich über diese beiden Debatten nachdenke, geht es mir nicht darum, Probleme zu relativieren oder sie sprachlich zu umschiffen. Im Gegenteil. Ich halte es für notwendig, Herausforderungen klar zu benennen – gerade dann, wenn sie im Alltag spürbar sind. Eine politische und gesellschaftliche Kultur, die Probleme nicht offen aussprechen kann, verliert an Glaubwürdigkeit.
Aber zwischen einer ehrlichen Problembeschreibung und der Wahl eines Begriffs, der ungewollt ganze Gruppen markiert, liegt ein entscheidender Unterschied. Probleme entstehen nicht dadurch, dass ein Begriff vorsichtig gewählt wird. Sie entstehen dadurch, dass Menschen in bestimmten Situationen Unterstützung brauchen, Orientierung suchen, Grenzen austesten oder in Konflikte geraten.
Sprache darf Probleme benennen – sie darf aber nicht Zugehörigkeit verhandeln.
Mir hilft hier meine Erfahrung aus der Mobilen Jugendarbeit, um einzuordnen, worum es eigentlich geht. Wenn ich heute an die Jugendlichen denke, mit denen ich früher auf der Straße gearbeitet habe, dann weiß ich: Viele von ihnen sind sichtbar. Sie hängen draußen ab, sie sind laut, sie stellen Fragen, sie fordern heraus. Und ja – manchmal machen sie auch Fehler, geraten in Konflikte oder überschreiten Grenzen. Das alles ist real.
Aber gleichzeitig weiß ich, wie viel in diesen jungen Menschen steckt und wie viele von ihnen einen beeindruckenden Weg gegangen sind, wenn sie die richtige Unterstützung bekommen haben. Was sie gebraucht haben, war nicht das Stehenbleiben in Debatten über „Stadtbilder“, sondern Menschen, die ihnen professionell begegnen, die ihre Lage ernst nehmen und die ihnen Wege zeigen, wie man aus schwierigen Situationen herauskommt.
Genau dafür steht die Mobile Jugendarbeit:
- für Beziehung statt Zuschreibung,
- für Unterstützung statt Stigmatisierung,
- für Lösungsarbeit statt Sichtbarkeitsdebatten.
In der Jugendarbeit wäre es absurd, zu behaupten, es gäbe keine Probleme. Natürlich gibt es sie. Aber der professionelle Umgang mit diesen Problemen basiert auf etwas anderem als öffentlichen Diskursen über Ordnung, Sichtbarkeit oder vermeintliche „Störung“.
Er basiert auf einem Grundsatz, den ich als zentral betrachte – nicht nur pädagogisch, sondern gesellschaftlich:
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie hängt nicht von Leistung ab, nicht von Anpassung und schon gar nicht davon, wie jemand in einem öffentlichen Raum wirkt.
Wer diesen Grundsatz ernst nimmt, kann Probleme offen ansprechen – ohne Menschen zu Objekten von Stimmungen zu machen.
Was wir aus diesen Debatten lernen können
Wenn ich auf diese Monate zurückschaue, dann zeigt sich für mich ein Muster, das weit über einzelne Begriffe hinausgeht. Es erinnert uns daran, dass Sprache nicht nur beschreibt, sondern lenkt. Dass politische Kommunikation Räume öffnet oder schließt – bewusst oder unbewusst. Und dass wir gut daran tun, darauf zu achten, wie wir über Probleme sprechen und nicht nur, dass wir es tun.
Wir lernen aus diesen Debatten, dass wir Probleme klar benennen müssen. Menschen merken, wenn Dinge nicht angesprochen werden. Aber wir lernen auch, dass wir nicht jedes Wort in ein Klima hineinwerfen können, das bereits von anderen bespielt wird. Eine demokratische Gesellschaft braucht beides: Mut zur Problembeschreibung – und Sorgfalt in der Sprache.
Denn es ist ein Unterschied, ob wir öffentliche Räume ordnen wollen oder soziale Gruppen adressieren. Und es ist ein Unterschied, ob wir über Konflikte sprechen oder über Zugehörigkeit.
Vielleicht ist das die zentrale Lehre: Es reicht nicht, destruktiven Kräften zu widersprechen. Wir müssen selbst verständlich machen, welche Lösungen wir haben – und warum sie besser sind. Dort, wo politische Kommunikation Handlung zeigt, entsteht Vertrauen. Dort, wo sie nur Abwehr reproduziert, entsteht Leere.
Ein stiller Ausblick zum ersten Advent
Der erste Advent ist kein lauter Moment. Eher ein Innehalten. Ein kurzes Ausatmen in einer Zeit, die für viele angespannt ist.
Vielleicht passt genau deshalb dieser Gedanke in den Tag: Dass gesellschaftliche Probleme nicht nur beschrieben werden müssen, sondern gestaltet werden können. Und dass wir uns nicht von jenen treiben lassen müssen, die nur das Problem ins Zentrum stellen, sondern von denen, die Wege zeigen.
Hoffnung entsteht dort, wo Handlung sichtbar wird. Nicht, weil die Welt dann einfacher ist. Sondern weil die Richtung klarer wird. Vielleicht ist das die eigentliche Bedeutung dieses Adventsmoments: dass wir Einfluss darauf haben, welche Räume wir mit Sprache öffnen – und welche wir schließen. Dass wir entscheiden können, ob Debatten Menschen kleiner machen oder größer.
Und dass es sich lohnt, diese Räume bewusst zu gestalten:
- Schritt für Schritt.
- Gespräch für Gespräch.
- Entscheidung für Entscheidung.
Und vielleicht blickt man irgendwann auf diese Monate zurück und sagt: Das war der Moment, in dem viele begonnen haben, genauer hinzuschauen, klarer zu sprechen – und mutiger zu handeln.


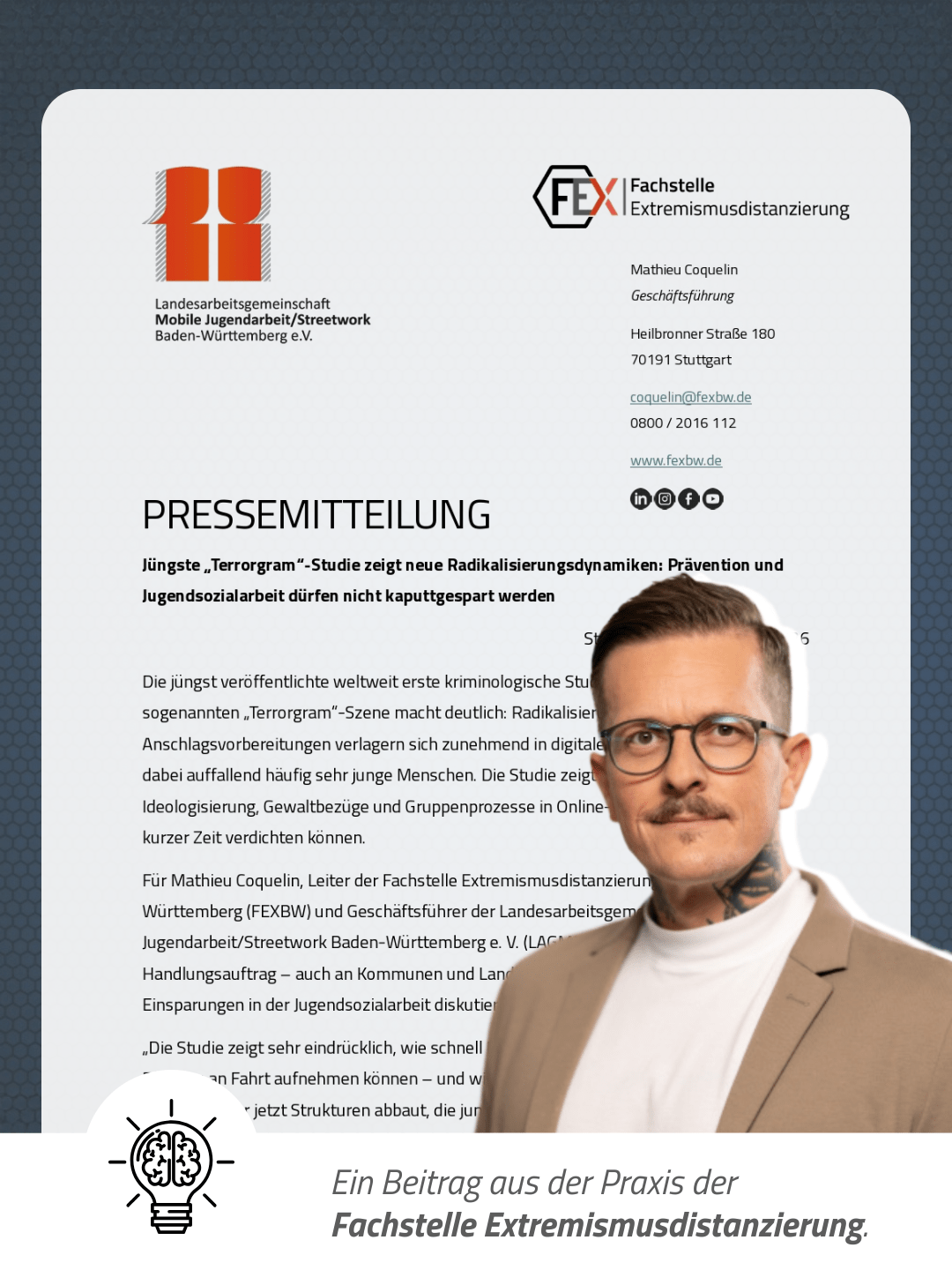


Schreibe einen Kommentar