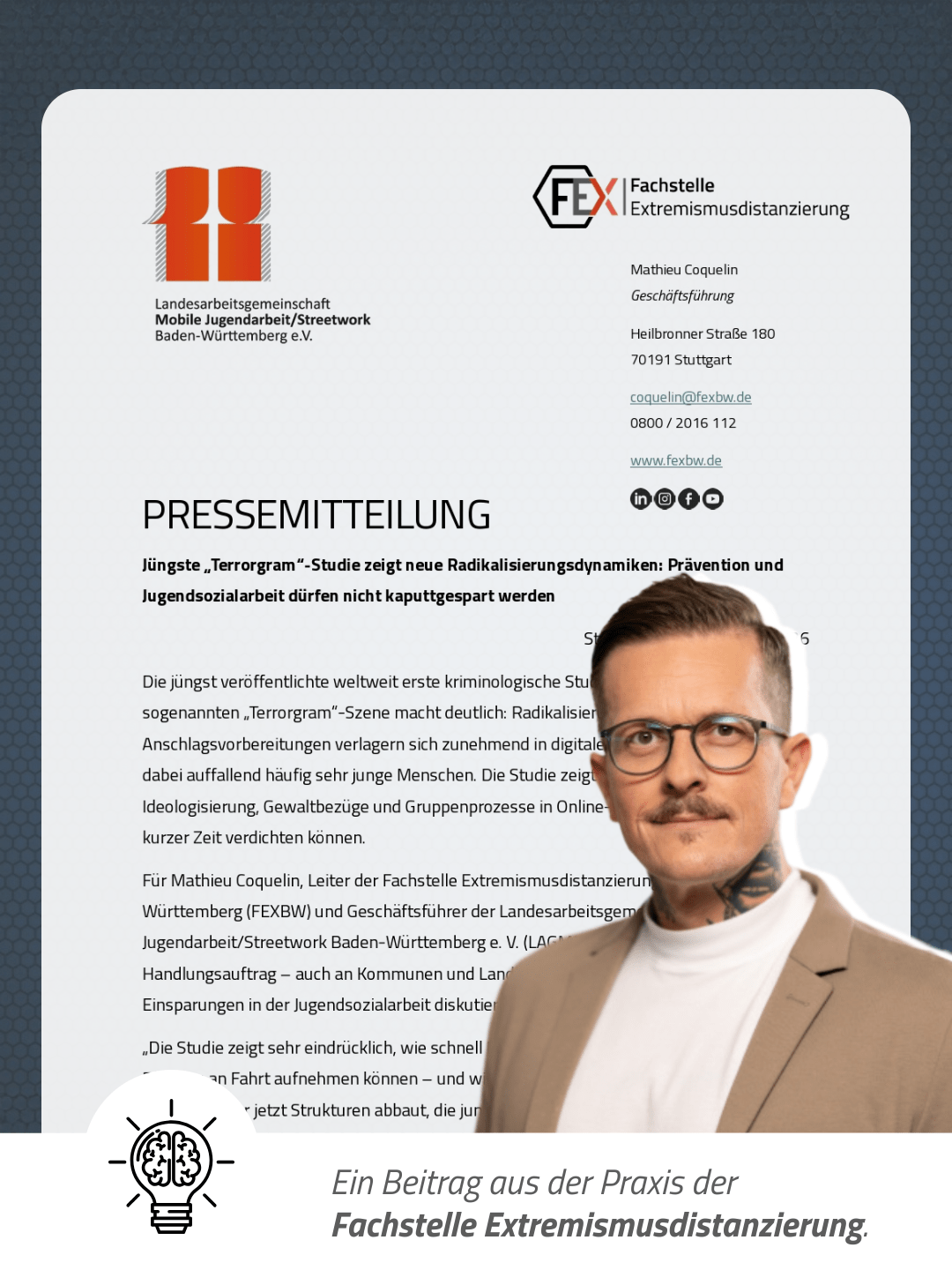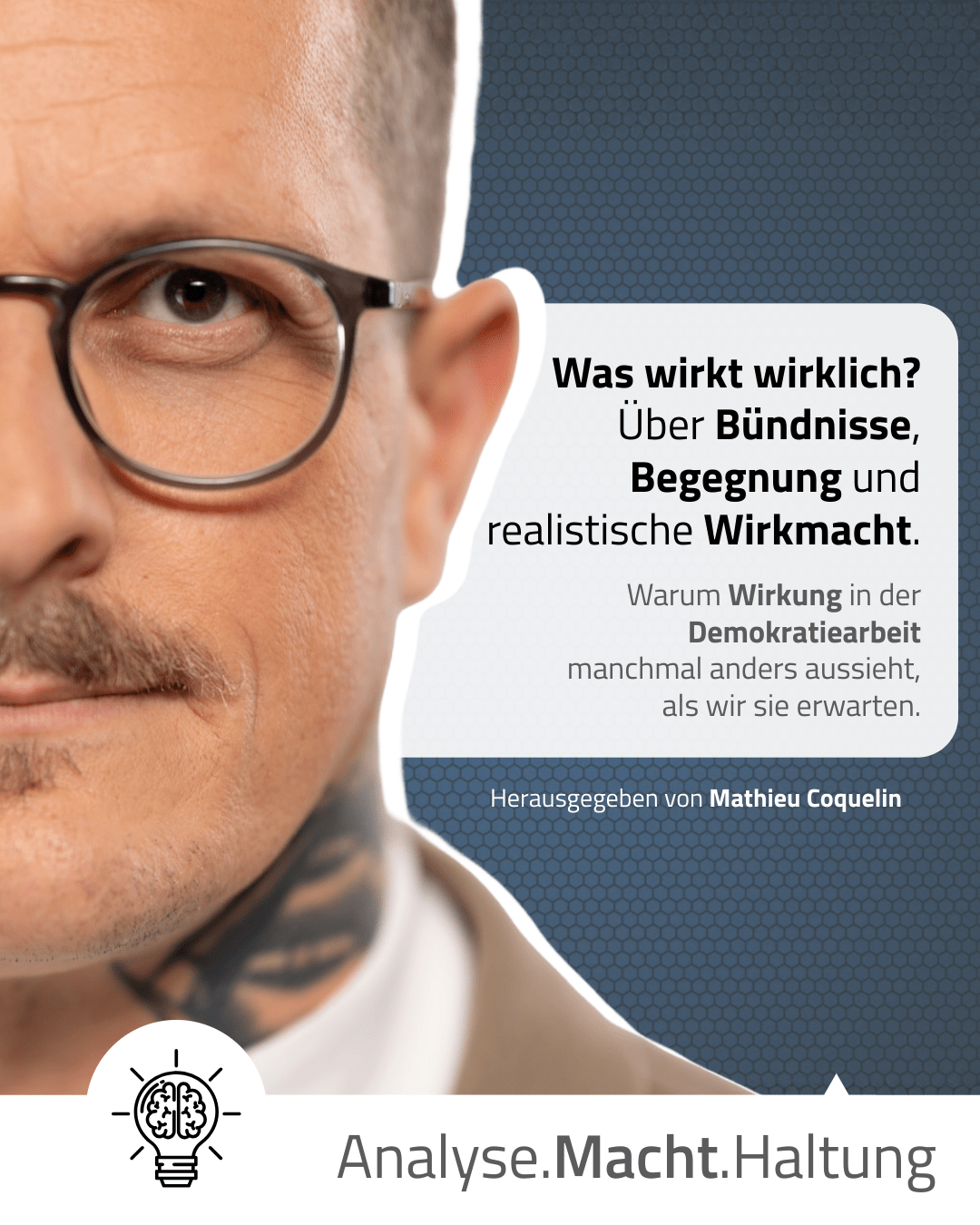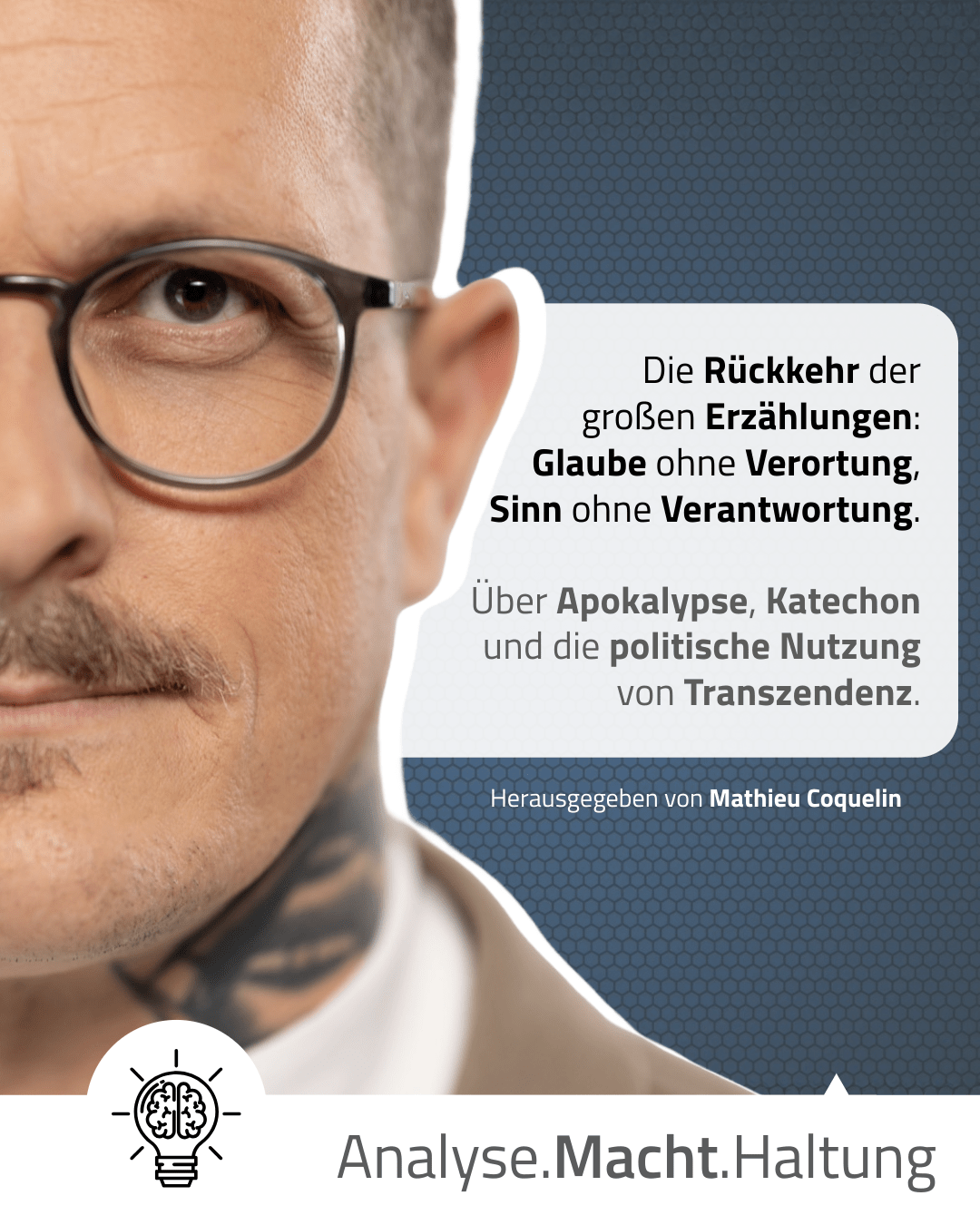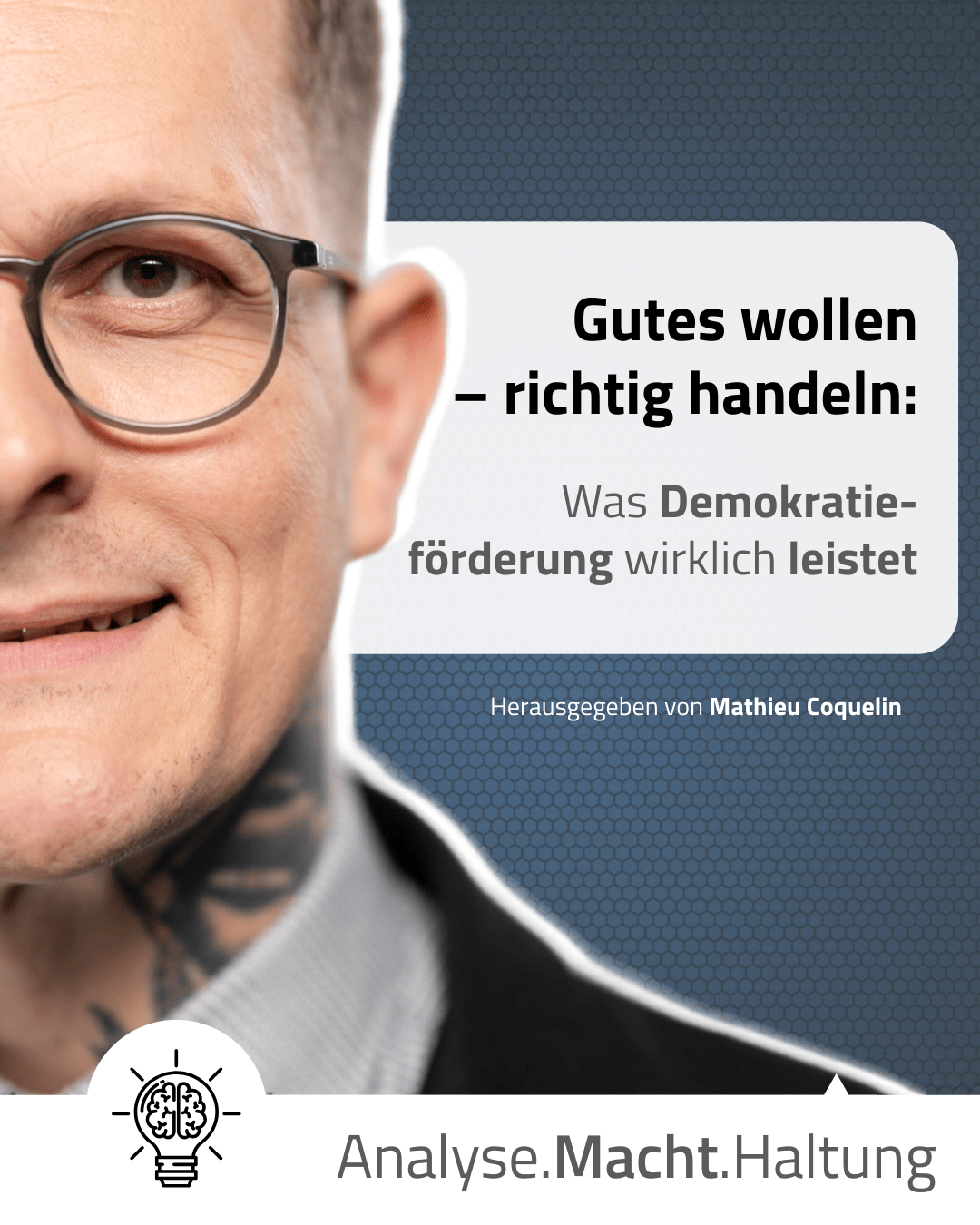
Demokratieförderung zwischen Anspruch und Wirkung
Perfekt ist keiner – verantwortlich schon
Als Taufspruch für meinen zweiten Sohn haben wir einen Satz aus dem Buch Prediger gewählt:
„Es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er Gutes tue und nicht sündige“ (Prediger 7,20).
Dieser Vers begleitet mich schon lange – auch weit über den privaten Rahmen hinaus. Für mich bedeutet er: Wo Menschen handeln, entstehen Fehler. Aber wer handelt, tut mehr, als wer sich nur empört. Spannend ist, wie sehr sich dieser biblische Gedanke mit einem anderen Leitspruch berührt, den wir an der Fachstelle seit Jahren leben: „Wer aufhört, besser sein zu wollen, hört auf, gut zu sein.“ Der eine Satz klingt nach reinster Evaluationslehre, der andere nach jahrtausendealter Weisheit – beide bringen die gleiche Demut zum Ausdruck: Perfektion bleibt unerreichbar, aber wir müssen im Handeln nach Verbesserungen streben.
Beide Aussprüche lassen offen, was eigentlich „gut“ und was „schlecht“ ist. Im biblischen Kontext liegt es nahe: Es ist nicht der Mensch, der darüber urteilt – auch wenn Menschen der Versuchung oft nicht widerstehen können, sich selbst in diese Position zu erheben. Aus dem zweiten haben wir in den vergangenen zehn Jahren vor allem abgeleitet, dass sich – bei einem klar unveränderbaren Ziel, nämlich Menschen Wege (zurück) in die Gesellschaft zu zeigen – Zeiten, Themen und Dynamiken wandeln. Und dass bei klarem „Was wollen wir tun?“ das „Wie wollen wir das erreichen?“ einer steten kritischen Überprüfung bedarf. Mahnung hierzu war ein anderes geflügeltes Wort: ‚Der Pfad zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.‘
Das bringt uns zu einem entscheidenden Punkt: Das Was und das Wie sind nie voneinander zu trennen. Ein klares Ziel reicht nicht aus, wenn die Umsetzung verfehlt ist. Wer das Richtige will, es aber falsch umsetzt, erreicht nichts Gutes. Und umgekehrt: Selbst die beste Methode macht nichts besser, wenn sie einem schädlichen Ziel dient.
Für die Demokratieförderung heißt das: Niemand, der die Entwicklungen der letzten Jahre verfolgt – Rechtsextremismus, wachsender Antisemitismus, internationale Einflussnahme in öffentliche Diskurse, die Zunahme verschwörungsideologischer Bewegungen – würde ernsthaft bestreiten, dass unsere Demokratie aktuell unter Druck steht. Daraus lässt sich ableiten: Das große Was – die Notwendigkeit von Demokratieförderung – sollte eigentlich nicht infrage stehen.
Das Feld ist jedoch breit: von politischer Bildung über die Vermittlung historischer Erfahrungen und Antidiskriminierungsarbeit bis hin zu Teilhabeprojekten und Formaten gegen religiösen Fundamentalismus oder andere extremistische Strömungen. Unterschiedliche Ziele bringen unterschiedliche Methoden hervor – und weil viele Ansätze neu sind, waren Fehler unvermeidlich. Umso wichtiger ist es, diese Prozesse sorgfältig zu begleiten und laufend zu prüfen, wie die Ziele am besten erreicht werden können.
Genau hier setzt dieser Artikel an. Ich möchte drei Dinge tun:
- Die Kritik ernst nehmen – und prüfen, wo sie auf reale Schwächen hinweist.
- Falsche Schlüsse aufzeigen – dort, wo Einzelfälle verallgemeinert oder politische Absichten über sachliche Befunde gestellt werden.
- Konstruktive Vorschläge entwickeln – wie Demokratieförderung wirksamer, nachhaltiger und transparenter gestaltet werden kann.
Drei Narrative in der aktuellen Debatte
Die Diskussion über Demokratieförderung ist in den vergangenen Monaten spürbar schärfer geworden. Ob in großen Tageszeitungen, in Magazinen oder im Bundestag: Immer wieder wird die Förderung von NGOs und Projekten kritisch befragt. Dabei fällt auf, dass die Argumente selten isoliert bleiben. Vielmehr verdichten sie sich zu wiederkehrenden Narrativen, die den öffentlichen Diskurs prägen.
Diese Narrative sind nicht alle von gleicher Qualität. Manche enthalten berechtigte Kritik am Wie – also an den Methoden und an der Umsetzung. Andere zielen auf das Was, indem sie einzelne Teilbereiche herausgreifen und daraus eine grundsätzliche Delegitimierung der Demokratieförderung ableiten. Und schließlich gibt es Argumentationsmuster, die jede Sachlichkeit verlassen und Demokratieförderung insgesamt in ein verschwörungstheoretisches Licht rücken.
In diesem Kapitel möchte ich diese drei Narrative genauer betrachten: Wo liegen berechtigte Beobachtungen? Wo werden falsche Schlüsse gezogen? Und welche Schlüsse lassen sich daraus für einen konstruktiven Umgang mit Kritik ableiten?
Narrativ 1: Sachliche Kritik am Wie
Ein Teil der aktuellen Berichterstattung konzentriert sich auf die Umsetzung von Demokratieförderung. Die Vorwürfe lauten etwa, dass Projekte ihre Zielgruppen nicht erreichen, dass Fördergelder versanden oder dass der messbare Nutzen unklar bleibt. In dieser Form ist die Kritik nicht aus der Luft gegriffen – gerade im Feld der Prävention und politischen Bildung ist es schwierig, Wirkungen eindeutig nachzuweisen. Häufig zeigen sich Erfolge nicht kurzfristig, sondern erst über längere Zeiträume. Und selbst dann bleiben sie oft indirekt: Weniger Schulabbrüche, mehr Handlungssicherheit bei Fachkräften oder ein gestärktes Bewusstsein für demokratische Werte lassen sich nicht so einfach zählen wie Teilnehmendenzahlen bei einem Workshop.
Trotzdem verdient diese Kritik Aufmerksamkeit. Sie erinnert daran, dass Demokratieförderung kein geschützter Raum ist, in dem Projekte allein aufgrund guter Absichten bestehen dürfen. Sie muss zeigen, dass sie Wirkung entfaltet – und sich auch daran messen lassen. Zugleich braucht es ein realistisches Verständnis dessen, was Wirkung in diesem Feld bedeutet: keine kurzfristigen Wunder, sondern langfristige Investitionen in Haltungen, Kompetenzen und Netzwerke.
Gerade in Baden-Württemberg zeigt sich dieser Punkt deutlich. In den vergangenen zehn Jahren haben wir erlebt, dass Reichweite Zeit braucht. Beratungsstellen und Distanzierungsangebote werden nicht von heute auf morgen bekannt. Es braucht Jahre, bis sich Fachkräfte in allen Regionen des Landes an eine neue Anlaufstelle wenden, Vertrauen aufbauen und die Angebote nutzen. Öffentlichkeitsarbeit ist dabei nur ein Teil – entscheidend ist das Netzwerkvertrauen, das über viele persönliche Kontakte, gemeinsame Fallbesprechungen und kontinuierliche Präsenz entsteht. Wer nach zwei Jahren Projektlaufzeit bemängelt, dass noch nicht jede Schule und jede Kommune das Angebot kennt, verkennt diese Dynamik.
Ein weiterer Punkt betrifft die Ressourcen. Arbeitet eine Beratungsstelle mit geringem Budget arbeitet, können nicht gleichzeitig landesweite Öffentlichkeitskampagnen, intensive Fallarbeit und umfassende Evaluation gestemmt werden. Dabei geht es nicht in erster Linie um ein Mehr an Geld, sondern um Planbarkeit: Demokratieförderung entfaltet ihre Wirkung nur dann, wenn Angebote über längere Zeiträume aufgebaut, etabliert und verlässlich fortgeführt werden können. Kurzfristige Projektlogiken dagegen verhindern, dass sich Netzwerke stabilisieren und Fachkräfte kontinuierlich arbeiten können. Kritik an mangelnder Sichtbarkeit oder Reichweite ist also nur dann sinnvoll, wenn auch die zeitliche und finanzielle Grundlage berücksichtigt wird, auf der die Arbeit überhaupt stattfinden kann.
Und schließlich zeigt die Praxis, dass Fallzahlen allein wenig aussagen. In der Distanzierungsarbeit etwa kann ein einzelner Jugendlicher, der durch intensiven Einsatz von Fachkräften stabilisiert wird, langfristig größere Wirkung entfalten als zehn oberflächlich erreichte Teilnehmende in einer Schulveranstaltung. Wirkung entsteht nicht durch Quantität allein, sondern durch Tiefe und Nachhaltigkeit.
Genau hier liegt die Herausforderung: Kritik am Wie ist wichtig – aber sie muss fair sein. Sie darf nicht so tun, als ließe sich Demokratieförderung mit denselben Maßstäben messen wie ein Infrastrukturprojekt. Sondern sie muss anerkennen, dass Prävention Vertrauen, Zeit und kontinuierliche Strukturen braucht.
Narrativ 2: Delegitimierung des Was
Ein zweites Muster in der Debatte richtet sich nicht auf die Umsetzung, sondern auf das Ziel selbst. Statt über Methoden zu diskutieren, wird hier die Legitimität bestimmter Schwerpunkte infrage gestellt – und daraus eine pauschale Kritik an der Demokratieförderung insgesamt abgeleitet.
Typisch ist, dass einzelne Themenfelder überproportional hervorgehoben werden, um das große Ganze zu diskreditieren. Wenn Demokratieförderung etwa auf Workshops zu sexueller Vielfalt reduziert wird, entsteht der Eindruck, als bestünde das gesamte Programm aus „Gender-Projekten“. In einem anderen Kontext wird betont, Demokratieförderung richte zu viel Aufmerksamkeit auf „rechte Netzwerke“ – und daraus die Behauptung abgeleitet, es handle sich um verdeckte parteipolitische Einflussnahme. Beide Lesarten verzerren das Bild: Sie picken Teilbereiche heraus und erklären sie zu Stellvertreter-Debatten für das gesamte Feld.
In der Realität umfasst Demokratieförderung jedoch eine enorme Breite, die nicht zufällig ist:
- Bildung und Teilhabe: Politische Bildung in Schulen und Kommunen, Förderung von Beteiligung.
- Antidiskriminierung: Schutz und Unterstützung in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern.
- Extremismusprävention: von religiösem Fundamentalismus bis hin zu rechtsextremen Strömungen.
- Beratung und Distanzierung: Angebote an den Schnittstellen von Sozialarbeit und Sicherheitsarchitektur.
Diese Vielfalt ist kein „Bauchladen“, sondern spiegelt die pluralen Bedrohungen wider, mit denen eine Demokratie konfrontiert ist. Sie folgt gesellschaftlichen Entwicklungen: das Erstarken salafistischer Netzwerke, rechtsterroristische Anschläge, die Corona-Pandemie mit ihren Verschwörungsmythen – all das hat neue Bedarfe sichtbar gemacht und Schwerpunkte verschoben. Wer diese Breite ausblendet und einzelne Bereiche überhöht, delegitimiert das Was auf zweierlei Weise: Einerseits wird suggeriert, Demokratieförderung bearbeite irrelevante Felder. Andererseits wird verschwiegen, dass gerade diese Vielfalt notwendig ist, weil Gefährdungen für die Demokratie nicht eindimensional sind.
Wer Demokratieförderung phänomenübergreifend denkt, darf sich allerdings auch unbequemen Themen nicht verschließen. Dazu gehört, anzuerkennen, dass es auch im Bereich linke Militanz oder gewaltorientierter Linksextremismus Radikalisierungsdynamiken gibt. Diese sind in ihrer Dimension nicht mit der Bedrohung durch Rechtsextremismus vergleichbar, doch sie existieren – und eine seriöse Präventionsarbeit muss beides im Blick behalten. Das ist kein Nachgeben auf rhetorische Stöckchen, sondern Ausdruck von Differenzierungsfähigkeit.
Ein zweiter selbstkritischer Punkt betrifft die Anschlussfähigkeit mancher Projekte. Zu oft wird stillschweigend vorausgesetzt, dass ihre Sinnhaftigkeit für alle Bürgerinnen und Bürger unmittelbar erkennbar ist. Was in akademischen oder fachpolitischen Kontexten selbstverständlich wirkt, erschließt sich nicht automatisch in der breiten Öffentlichkeit. Demokratieförderung muss deshalb nicht nur inhaltlich überzeugen, sondern ihre Legitimität kommunikativ immer wieder neu begründen.
Das Problem liegt also nicht darin, dass Demokratieförderung zu breit aufgestellt wäre – sondern darin, dass die Debatte zu schmal geführt wird. Wer über Demokratieförderung spricht, sollte sich nicht an Einzelfeldern abarbeiten, sondern die Gesamtarchitektur in den Blick nehmen. Nur so lässt sich fair beurteilen, ob das große Was – die Stärkung demokratischer Resilienz – erreicht wird.
Narrativ 3: Verschwörungserzählungen und die Dämonisierung des Ganzen
Ein drittes Muster geht noch weiter: Es verlässt die Ebene von Was und Wie und unterstellt gleich eine feindliche Gesamtarchitektur. Kritik wird nicht mehr mit Fakten begründet, sondern in das Vokabular von Verschwörungserzählungen übersetzt.
So war jüngst von einem „linken Deep State“ im Familienministerium zu lesen. Der Begriff stammt aus einem verschwörungsideologischen Umfeld, das in den USA populär wurde und dort für die Behauptung steht, ein unsichtbarer Staat im Staat manipuliere die Gesellschaft. Wer ihn im deutschen Kontext übernimmt, tut mehr, als nur Kritik an Förderprogrammen zu äußern. Es wird eine ganze „Parallelwelt“ konstruiert: NGOs erscheinen nicht mehr als Akteure mit bestimmten Projekten oder Schwächen, sondern als Teil einer geheimen Machtstruktur.
Damit verschiebt sich der Fokus: Es geht nicht mehr um die Frage, ob Demokratieförderung wirkt oder wie sie verbessert werden kann, sondern um die Unterstellung böser Absichten. Die Debatte verliert dadurch ihre argumentative Grundlage und verwandelt sich in eine Erzählung vom „guten Volk“ gegen „korrupte Eliten“. Genau hier verschwimmen die Grenzen zwischen politischer Kritik und verschwörungsideologischer Delegitimierung demokratischer Institutionen.
Die Gefahr solcher Narrative liegt nicht nur in ihrer Unsachlichkeit. Sie wirken auch destruktiv auf das öffentliche Klima:
- Sie machen seriöse Kritik verdächtig, weil diese in den gleichen Topf geworfen wird.
- Sie verschieben die Aufmerksamkeit weg von realen Schwächen hin zu Fantasiekonstruktionen.
- Sie beschädigen das Vertrauen in Zivilgesellschaft insgesamt – und zwar auch dort, wo sie konkrete Probleme tatsächlich bearbeitet.
Damit schaden sie am Ende nicht nur den Trägern von Demokratieförderung, sondern auch dem demokratischen Diskurs selbst. Denn wer sich auf eine „Deep State“-Logik einlässt, kann keinen konstruktiven Dialog mehr führen – er sucht keine Verbesserung, sondern Bestätigung seiner Feindbilder.
Deshalb gilt: Eine ernsthafte Debatte über Demokratieförderung muss Verschwörungserzählungen klar abgrenzen. Kritik ist wichtig, aber sie braucht den Boden der Realität. Wer über Demokratieförderung spricht, darf nicht auf Bilder vom Bösen ausweichen, sondern muss über Ziele, Methoden und Strukturen reden. Nur so bleibt die Diskussion fruchtbar – und bewahrt die Chance, aus Kritik tatsächlich Weiterentwicklung entstehen zu lassen.
Zwischenfazit: Von der Kritik zur Erzählung
Die drei Narrative zeigen eine klare Dynamik: Unscharfe Kritik am Wie führt schnell dazu, dass das Was delegitimiert wird – und von dort ist es nur noch ein kleiner Schritt in verschwörungstheoretische Zuschreibungen, die nicht mehr über Wirksamkeit diskutieren, sondern gleich eine feindliche „Parallelwelt“ oder gar einen „Deep State“ konstruieren. Genau in dieser Bewegung liegt die eigentliche Gefahr: Wer Ebenen vermischt, öffnet unbeabsichtigt Türen, durch die andere mit radikaleren Deutungen schreiten können. So wird aus berechtigter Wirksamkeitskritik eine pauschale Abwertung von Demokratieförderung – und am Ende ein Misstrauen, das nicht nur einzelne Projekte, sondern die demokratische Infrastruktur insgesamt beschädigt.
Damit Kritik nicht in diese Sackgasse führt, braucht es einige klare Leitlinien:
- Zivilgesellschaft als Teil der Gesellschaft begreifen: Zivilgesellschaftliche Akteure handeln in den Rahmungen, die Politik und Gesellschaft vorgeben. Kritik darf nicht so tun, als sei die Zivilgesellschaft ein homogener Block mit Eigeninteressen, sondern muss anerkennen, dass hier gesellschaftliche Aufgaben übernommen werden, die andernfalls beim Staat lägen.
- Unterscheiden lernen: Politik, Medien und Öffentlichkeit sollten sauber zwischen Was und Wie trennen – Kritik an Methoden darf nicht zur Delegitimierung des Ziels werden.
- Sprache reflektieren: Begriffe wie „Parallelwelt“ oder „Deep State“ sind nicht neutral. Sie verschieben den Diskurs in verschwörungsideologische Muster und sollten bewusst vermieden oder klar eingeordnet werden.
- Erklärarbeit leisten: Projekte dürfen ihre Sinnhaftigkeit nicht als selbstverständlich voraussetzen, sondern müssen sie immer wieder neu erklären und kommunizieren – auch jenseits ihrer unmittelbaren Zielgruppen.
- Planbarkeit vor Quantität: Es geht weniger um „immer mehr Geld“ als um längerfristige Planungssicherheit. Demokratieförderung braucht Stabilität, nicht permanente Projektlogik.
So verstanden, kann Kritik zu einer Chance werden: nicht als Einstieg in Misstrauen, sondern als Ausgangspunkt für Weiterentwicklung.
Praxisblick Baden-Württemberg
Das Was unserer Arbeit
Um die aktuelle Debatte einzuordnen, lohnt sich ein Blick auf die Vielfalt des Bundesprogramms Demokratie leben!. Es ist kein monolithischer Block, sondern ein Dach für hunderte ganz unterschiedliche Ansätze: von Antidiskriminierungsprojekten über Jugendbeteiligung bis hin zur Radikalisierungsprävention. Manche Träger arbeiten an Schulen, andere in Vereinen, wieder andere in spezifischen Communities. Genau diese Spannweite macht die Einordnung so schwer – und erklärt zugleich, warum Kritik, die aus einem Einzelbeispiel eine Generaldiagnose ableitet, oft zu kurz greift.
Die Entwicklung des Programms war zudem nie statisch, sondern immer eng an gesellschaftliche und globale Ereignisse gebunden.
- Das Erstarken des sogenannten Islamischen Staates und die bis heute wachsende salafistische Szene führten zum Ausbau von Präventionsangeboten.
- Rechtsextreme und rechtsterroristische Anschläge – von der NSU-Mordserie über den Mord an Walter Lübcke bis hin zu Halle und Hanau – rückten Rechtsextremismus und Antisemitismus noch stärker in den Fokus.
- Die Corona-Pandemie brachte neue Verschwörungsmythen hervor und beschleunigte bestehende Radikalisierungsmuster.
- Auch linke Militanz, Antisemitismus oder verschwörungsideologische Strömungen haben eigene Schwerpunkte begründet.
Unsere Arbeit in Baden-Württemberg bewegt sich in zwei dieser Stränge:
- Modellprojekte, die Neues erproben – von universitären Formaten wie Vorlesungen und Seminaren, die wir über fünf Jahre evaluiert haben, bis hin zu Workshops für Multiplikatoren, die pädagogische Fachkräfte auf den Umgang mit Radikalisierung vorbereiten. Sie sind bewusst experimentell angelegt: Sie sollen Methoden entwickeln, Impulse setzen und neue Wege öffnen – auch wenn nicht jeder Ansatz dauerhaft Bestand hat.
- Distanzierungshilfen, die kein Projekt sind, sondern ein kontinuierliches Angebot. Sie setzen dort an, wo Jugendliche und junge Erwachsene erste Warnsignale zeigen, wo Umfelder Orientierung brauchen und punktgenaue Unterstützung nötig ist, bevor sich Radikalisierung verfestigt. Damit unterscheiden sie sich klar von der klassischen Ausstiegsarbeit, die in aller Regel Erwachsene adressiert, die bereits tief in extremistische Szenen eingebunden sind.
Rund 80 bis 90 Prozent unserer Arbeit findet im indirekten Setting statt: Wir qualifizieren und beraten Fachkräfte, die tagtäglich in Schulen, Jugendhilfe oder Polizei mit solchen Jugendlichen zu tun haben. Nur etwa 10 bis 20 Prozent unserer Arbeit besteht in direkter Begleitung junger Menschen – ein Bereich, den wir seit 2025 ausgebaut haben.
Dieser Ansatz – zwischen breiter Prävention und individueller Ausstiegsarbeit – ist in den letzten zehn Jahren in Baden-Württemberg gewachsen. Und er konnte nur entstehen, weil wir konsequent auf die Zusammenarbeit mit den vorhandenen Regelstrukturen gesetzt haben: mit dem Kultusministerium, wenn es um Schulen geht, mit dem Innenministerium, wenn es um Sicherheit geht, und mit den Sozialministerien, wenn es um Jugendhilfe geht. Die Distanzierungshilfen zeigen damit, dass Demokratieförderung nicht nur auf Projektebene, sondern als dauerhafter Bestandteil einer Präventionsarchitektur wirken kann.
Das Wie unserer Arbeit
Wenn über Demokratieförderung gesprochen wird, entsteht in der öffentlichen Debatte oft der Eindruck, als gäbe es hier ein geschlossenes Netzwerk mächtiger NGOs, die über Jahre hinweg ungestört und finanziell abgesichert eine Parallelstruktur aufgebaut hätten. Wer das Programm von innen kennt, weiß: Dieses Bild stimmt nicht.
Allein schon ein Blick auf die Träger zeigt, wie heterogen das Feld ist. Vom kleinen Jugendverein in der Fläche über kommunale Einrichtungen bis hin zu bundesweit agierenden Organisationen reicht die Spannweite – mit völlig unterschiedlichen Strukturen, Reichweiten und Möglichkeiten. Viele konkurrieren jedes Jahr aufs Neue um Mittel. Statt einer homogenen Front herrscht also Vielfalt, aber auch Unsicherheit.
Selbst dort, wo im Bundesprogramm über die Jahre institutionelle Funktionen aufgebaut wurden – etwa die Landesdemokratiezentren, die heute in allen Bundesländern existieren – ist die Finanzierungsgrundlage nicht dauerhaft. Auch sie laufen über Projektlogik, müssen regelmäßig Anträge stellen und sind auf die inhaltlichen Vorgaben aus Berlin angewiesen. Über die Schwerpunkte haben die Träger selbst kaum ein Mitspracherecht: Sie werden von Ministerien gesetzt und von den Ländern in die Fläche getragen.
Das zeigt auch, warum die verbreitete Erzählung von der „Macht der NGOs“ nicht trägt. Ja, in Berlin gibt es Träger, die durch ihre Nähe zur Bundespolitik stärker Einfluss nehmen können. Aber für die große Mehrheit – etwa eine kleine Partnerschaft für Demokratie in einer Kleinstadt – gilt: Mit 20.000 Euro Fördermitteln lässt sich keine Lobbyabteilung finanzieren. Diese Organisationen stemmen ihre Arbeit vor Ort mit knappen Ressourcen, unsicheren Perspektiven und viel ehrenamtlichem Engagement.
Für uns in Baden-Württemberg bedeutet das konkret: Auch unsere Angebote – ob Modellprojekte oder Distanzierungshilfen – entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern in diesem Spannungsfeld von Vorgaben, Abhängigkeiten und Förderlogik. Wirkung entsteht trotzdem – nicht durch Macht oder Dauerfinanzierung, sondern durch Netzwerke, Vertrauen und ein professionelles Prozess-Design.
Im Alltag heißt das: feste Andockpunkte in der Kinder- und Jugendhilfe und in Schulen, klare Schnittstellen in die Sicherheitsarchitektur, verlässliche Ansprechpartner in Kommunen. Diese Stabilität ist die Voraussetzung dafür, dass einzelne Maßnahmen nicht verpuffen, sondern in Routinen übergehen.
Was das für die Frage nach Wirkung bedeutet, erklären wir im nächsten Kapitel – dort, wo es um Evaluation, Weiterentwicklung und Transparenz geht.
Evaluation, Evolution und Transparenz
Unser Evaluationsdesign – fünf Jahre, formativ, praxisnah
Wir haben unsere Arbeit nicht punktuell überprüft, sondern über fünf Jahre systematisch begleitet. Dabei setzten wir auf eine formative Evaluation mit gemischten Methoden: standardisierte Vorher-/Nachher-Items, qualitative Kurzfeedbacks, vertiefende Interviews und Fallreflexionen. Die Evaluation war kein Schönwetter-Controlling, sondern diente der Steuerung: Was wirkt, für wen, unter welchen Bedingungen?
Die Ergebnisse waren eindeutig:
- Teilnehmende entwickelten eine höhere Sensibilität für Radikalisierungsanzeichen.
- Das Deutungswissen über ideologische Muster wuchs, gerade in Graubereichen.
- Die Handlungssicherheit stieg: Fachkräfte wussten klarer, welche Rolle sie haben und welche nächsten Schritte möglich sind.
- Die Kenntnis von Anlaufstellen verbesserte sich, und Schwellen zur Inanspruchnahme sanken.
Besonders deutlich zeigte sich: Wirkung ist kontextabhängig. Sie entfaltet sich dann am stärksten, wenn Fachkräfte netzwerkübergreifend geschult werden (z. B. Schule, Jugendhilfe, Polizei gemeinsam) und wenn es Follow-ups gibt, die eine Reflexion von Fällen ermöglichen.
Vom Modellprojekt zur Struktur – Evolution durch Anbindung
Entscheidend war, dass wir die Ergebnisse nicht in einer Projektblase belassen haben. In der zweiten Förderperiode entwickelten wir – angedockt an die Fachstelle und die DHBW, unterstützt durch das Sozialministerium – ein Forschungsprojekt, das in einem Curriculum mündete. Dieses Curriculum wirkt bis heute weiter:
- als Wahlmodul an der DHBW,
- in adaptierten Formen im Studium Generale anderer Hochschulen (z. B. am KIT oder am Institut für Business Analytics),
- sowie in der Ausbildung von Jugendsachbearbeitern in Kooperation mit dem Landeskriminalamt.
Alle diese Formate unterliegen eigenen Evaluationsmechanismen – von Hochschulen ebenso wie von Polizei und Fachstellen – und zeigen vergleichbare Ergebnisse. Damit sind unsere Befunde nicht nur intern abgesichert, sondern auch extern validiert.
Rechtlich-politischer Rahmen – Transparenz als Pflicht
Auch das Umfeld, in dem Demokratieförderung arbeitet, ist klar geregelt:
- Verfassungstreue und FDGO sind verpflichtender Bestandteil jedes Zuwendungsbescheids.
- Mitarbeitende, die eng mit Sicherheitsbehörden kooperieren, sind in aller Regel zuverlässigkeitsüberprüft – ein Standard, der Vertrauen schafft.
- Allgemeine Nebenbestimmungen und Landeshaushaltsrecht sichern die Mittelverwendung; in der Berichterstattung kann der Bundesrechnungshof nur mit seiner Kritik zitiert werden, weil er volle Transparenz erhält.
Kurz gesagt: Förderlogik und Kontrolle sind längst vorhanden. Das Problem liegt weniger im Fehlen von Transparenz, sondern darin, wie wir Evaluation und Verstetigung so gestalten, dass Wirkung nicht von Zufällen oder Projektlaufzeiten abhängt.
Was wir daraus ableiten
- Mehrjährige Zyklen mit Zwischen-Reviews statt jährlicher „Neuerfindung“.
- Verbindliche Transferpläne in Modellprojekten, damit Ergebnisse in Strukturen übergehen.
- Gemeinsame Kennzahlen mit Regelstrukturen: Outcome statt bloßer Output.
- Standardisierte Netzwerkroutinen (z. B. Fallreflexionen), damit Wirkung unabhängig von Einzelpersonen bleibt.
So entsteht eine Demokratieförderung, die Wirkung nicht nur misst, sondern auch verstetigt – und dabei transparent und überprüfbar bleibt.
Fazit & Ausblick
Wer Demokratieförderung fair beurteilen will, muss Ziel (Was) und Methode (Wie) trennen. Vieles von der aktuellen Kritik verwechselt beides – und erzeugt so ein Zerrbild. Das ist, als würde man der Feuerwehr vorwerfen, sie lösche keine Brände, und dann ausgerechnet Gerätewartung oder Leitstelle als ‚Beweis‘ anführen. Ohne diese Einheiten löscht am Ende überhaupt niemand ein Feuer – genauso wie Demokratieförderung ohne stabile Beratungsstellen, fachliche Qualifizierung und verlässliche Schnittstellen in die Sicherheitsarchitektur keine nachhaltige Wirkung entfalten kann.
Aus der Analyse und unseren zehn Jahren Praxis in Baden-Württemberg folgen für mich fünf klare Linien:
- Was/Wie sauber trennen. Kritik an Methoden darf nicht in eine Delegitimierung des Ziels kippen. Das große Was – demokratische Resilienz stärken, Radikalisierung vorbeugen, Handlungsfähigkeit von Fachkräften erhöhen – ist breit anschlussfähig.
- Planbarkeit vor Programmsprüngen. Es geht nicht um „immer mehr Geld“, sondern um verlässliche Mehrjährigkeit für die Teile der Landschaft, die Daueraufgaben erfüllen (z. B. Distanzierungshilfen, Beratungs- und Koordinierungsstellen). Projektlogik bleibt wichtig – aber als Labor, nicht als Dauerzustand.
- Evaluation als Lernschleife, nicht als Alibi. Wirkungsmessung muss Outcome sichtbar machen (Handlungssicherheit, Fallbearbeitungstiefe, Netzwerkwirkung), nicht nur Output zählen. Formativ, mehrjährig, mit Follow-ups – so wird aus Daten Steuerungswissen.
- Andocken an Regelstrukturen. Alles, was bleibt, bleibt über Schulen, Jugendhilfe, Kommunen und Sicherheitsarchitektur. Modellprojekte brauchen verbindliche Transferpläne; Daueraufgaben gehören in Dauerfinanzierung.
- Sprache mit Verantwortung. Begriffe wie „Parallelwelt“ oder „Deep State“ sind keine Analyse, sondern Brandbeschleuniger. Wer sie nutzt, verschiebt den Diskurs von Verbesserungen hin zu Feindbildern – und schadet am Ende der Prävention.
Ausdrücklich empfehlen möchte ich allen, die sich sachlich einlesen wollen: das Factsheet und die Studie der Maecenata Stiftung. Beide bieten einen nüchternen Überblick zur Rolle und Wirkung zivilgesellschaftlicher Demokratieförderung.
Ein Punkt liegt mir zum Schluss besonders am Herzen: Jeder Euro, der klug in Regelstrukturen investiert wird, spart Folgekosten. Das zeigen Wirkungslogiken aus der Jugendhilfe, der Schulsozialarbeit und der Kriminalprävention immer wieder: früh, verlässlich, vernetzt ist günstiger als spät, punktuell, reaktiv. Unsere Erfahrung aus der Distanzierungsarbeit bestätigt das – vor allem dort, wo Fachkräfte systematisch qualifiziert, Fälle netzwerkbasiert reflektiert und Anlaufstellen niedrigschwellig erreichbar sind.
Und damit schließt sich der Bogen zur Einleitung: Gute Vorsätze reichen nicht. Der Weg zur sprichwörtlichen Hölle ist gepflastert mit Projekten ohne Anschluss, Debatten ohne Differenzierung und Sparlogik ohne Weitblick. Wer aus berechtigter Kritik die richtigen Schlüsse ziehen will, muss zweierlei tun: das Richtige wollen – und es richtig umsetzen. Genau darin liegt unser Angebot: mit belastbarer Wirkung, enger Verzahnung der Regelstrukturen und der Demut, laufend besser werden zu wollen.