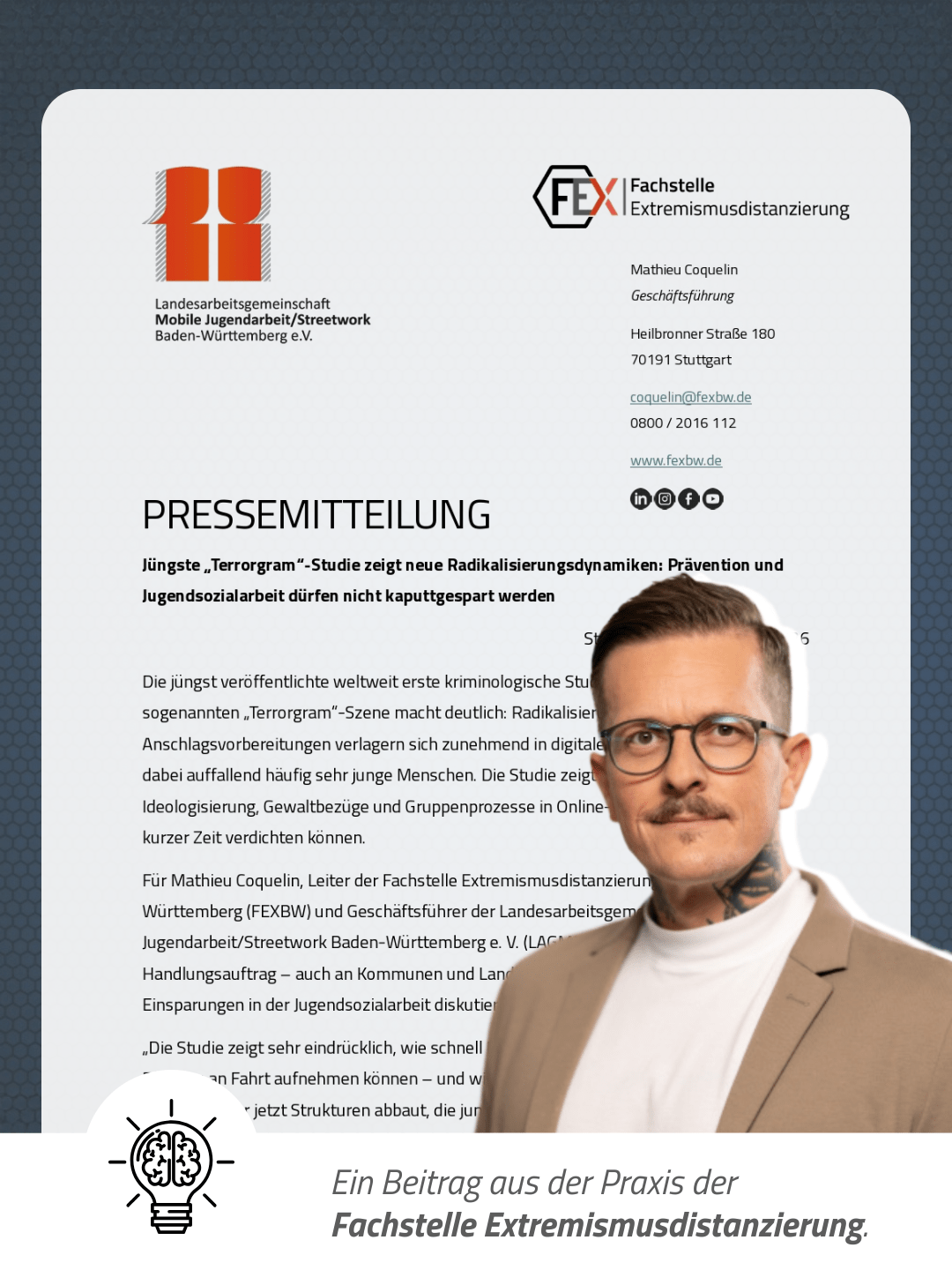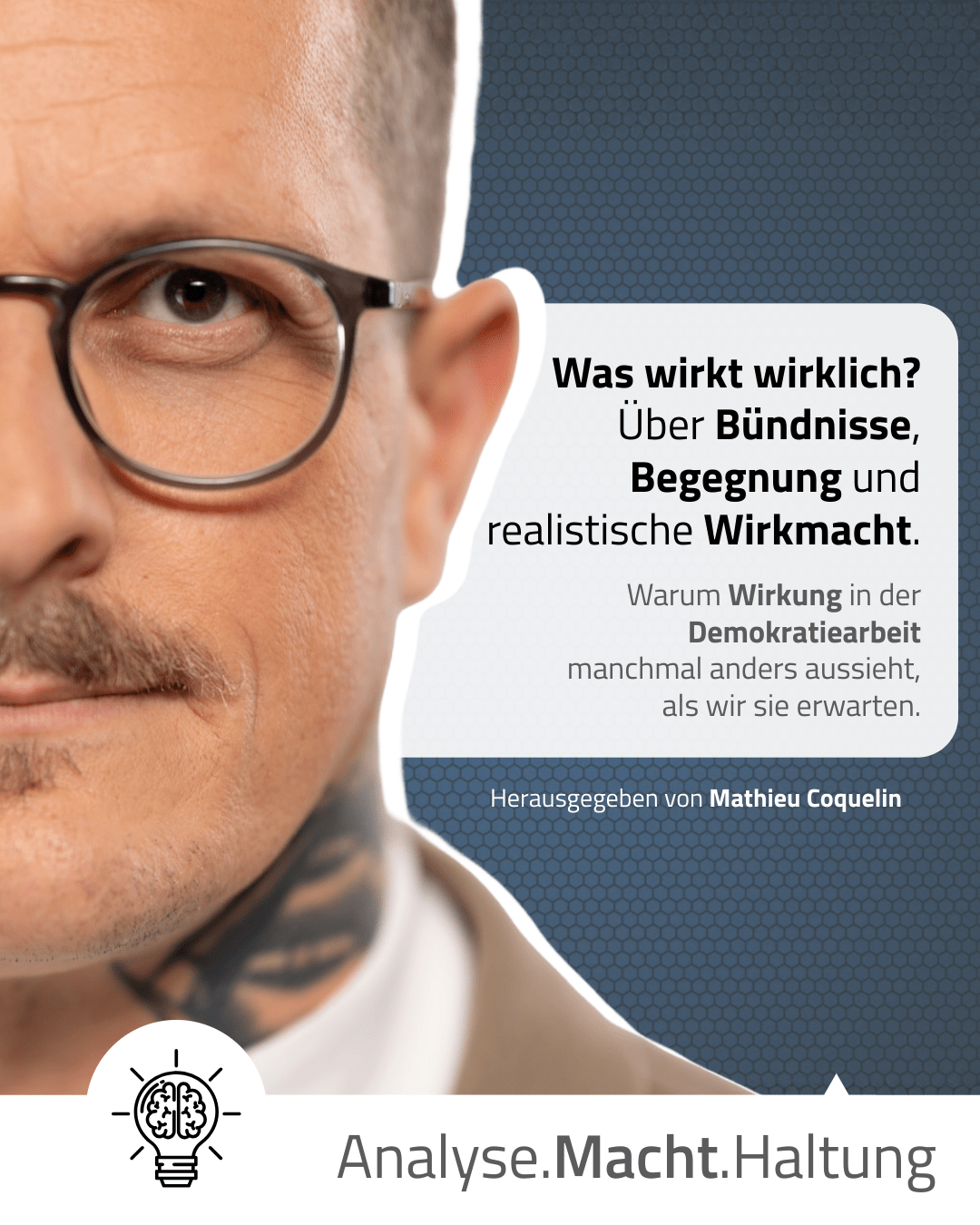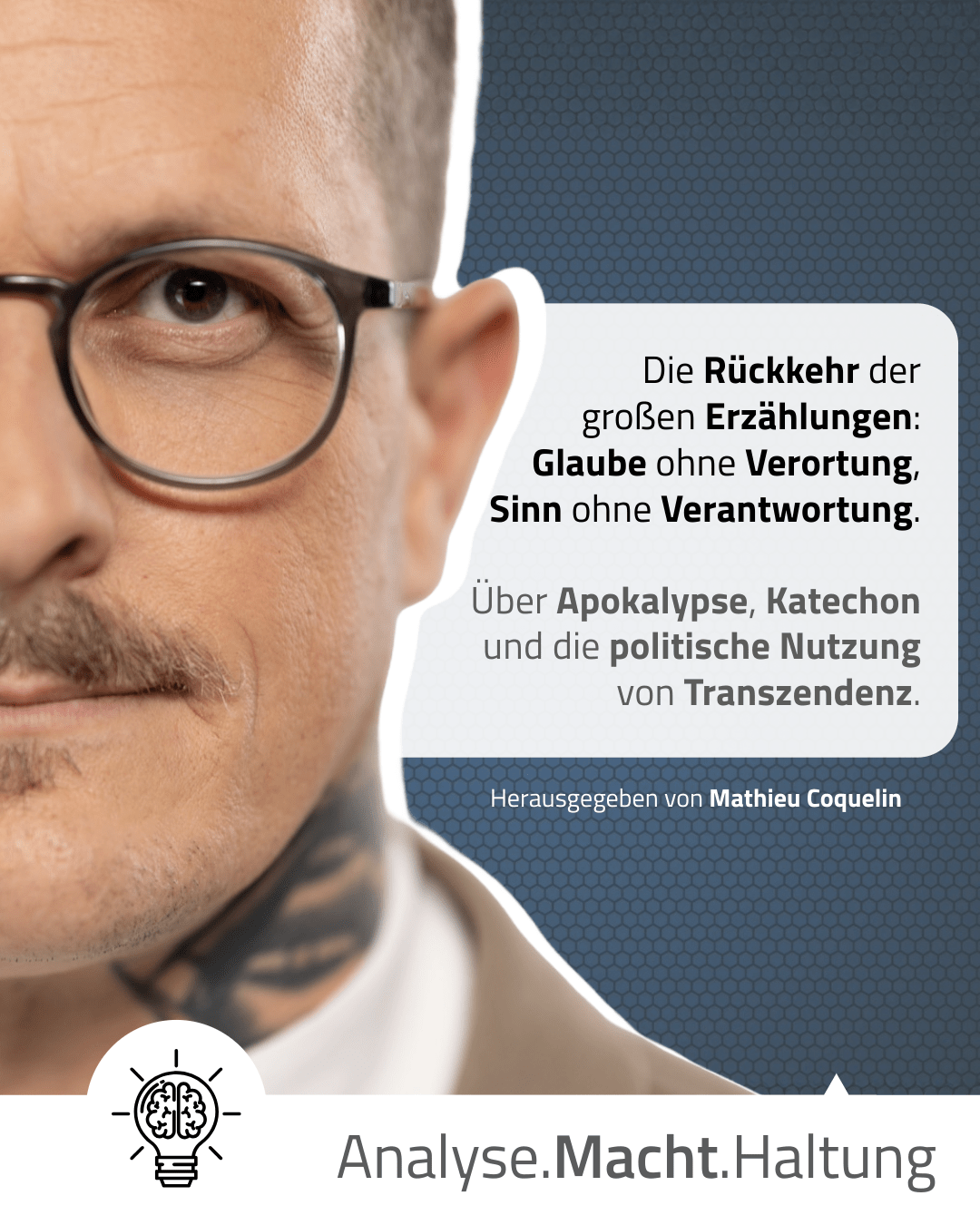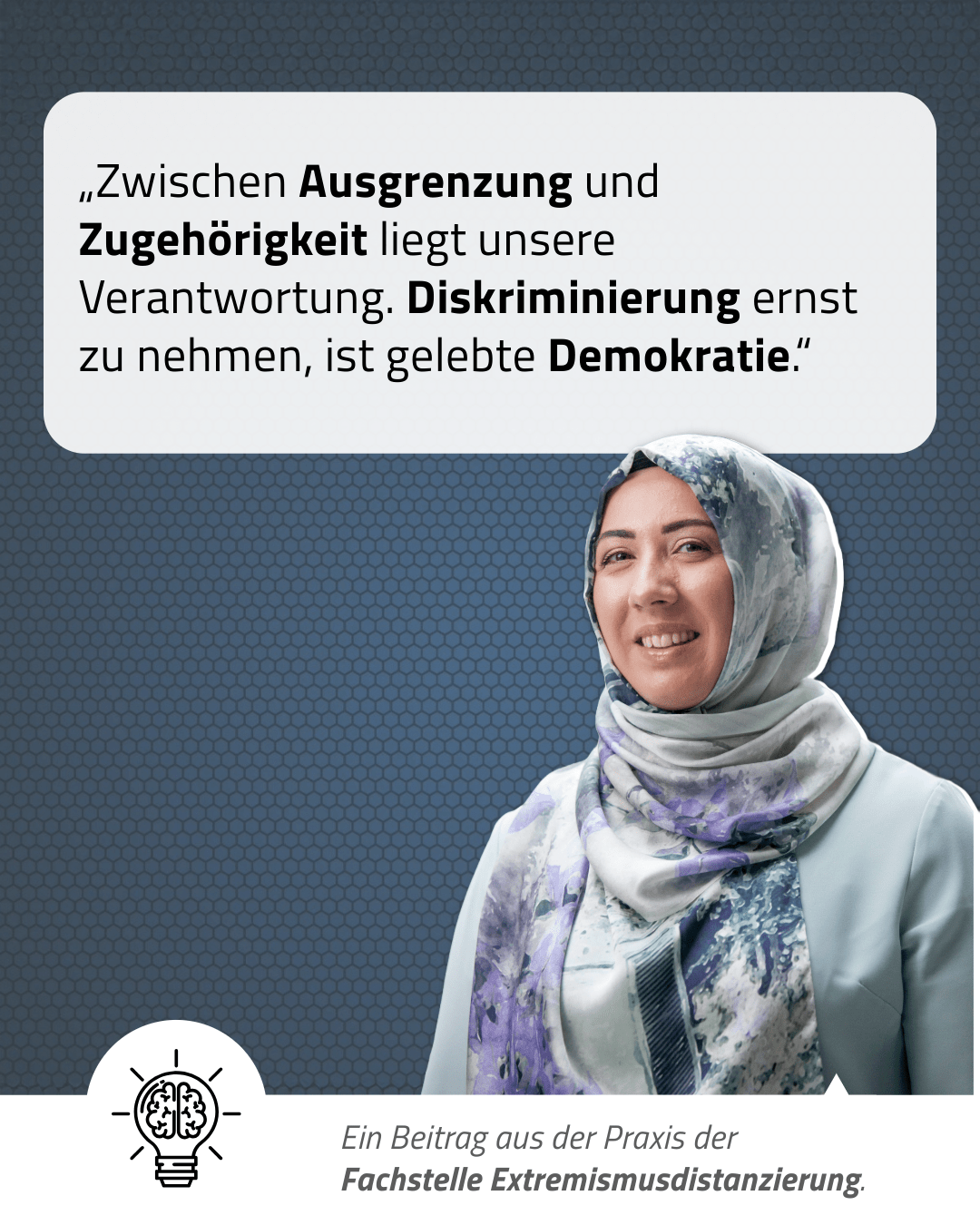
Diskriminierung als Nährboden für Radikalisierung?
Neue Studien und ihre Bedeutung für die Extremismusdistanzierung
In der Extremismusdistanzierung bewegen wir uns an der Schnittstelle zwischen individuellen Erfahrungen, gesellschaftlichen Spannungen und ideologischen Überformungen. Ein zentrales Muster zeigt sich dabei immer wieder: Diskriminierung ist nicht nur Ausdruck gesellschaftlicher Spaltung, sondern auch ein möglicher Nährboden für Radikalisierung.
Mehrere aktuelle Studien aus den Jahren 2024 und 2025 unterstreichen diese Verbindung. Sie fordern uns auf, Diskriminierung als Risikofaktor ernst zu nehmen – nicht nur aus der Opferperspektive, sondern als gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die in alle Lebensbereiche hineinwirkt.
Aktuelle Studienlage: Eine gesamtgesellschaftliche Realität
Mit dem fünften Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes („Diskriminierung in Deutschland“, 09/2024) liegt erstmals eine systematische Erhebung zu den Erfahrungen von EU-Bürger:innen in Deutschland vor. Die Ergebnisse machen deutlich: Diskriminierung im Gesundheitswesen, im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt ist kein Randphänomen – sondern Alltag.
Noch eindrücklicher verdeutlicht der Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor (NaDiRa) des DeZIM-Instituts (03/2025) die Tragweite: Über die Hälfte der befragten Menschen aus ethnischen oder religiösen Minderheiten geben an, regelmäßig rassistische Diskriminierung zu erfahren. Es sind keine Einzelfälle – diese Erfahrungen summieren sich, prägen Biografien und untergraben das Vertrauen in demokratische Institutionen.
In der psychosozialen Beratung spiegelt sich das in Aussagen wie:
„Warum sollte ich noch an den Staat glauben, wenn ich mich selbst bei einem Arztbesuch wie ein Mensch zweiter Klasse fühle?“
Psychosoziale Effekte und biografische Verletzungen
Die Meta-Analyse der Universität Mannheim (02/2024) stützt diese subjektiven Eindrücke empirisch. Sie zeigt, dass Diskriminierung ein signifikanter psychischer Stressor ist. Menschen, die regelmäßig Diskriminierung erleben, entwickeln mit höherer Wahrscheinlichkeit Depressionen, Angststörungen und posttraumatische Belastungen. Diese psychologische Disposition kann eine Rolle in Radikalisierungsprozessen spielen – insbesondere, wenn die Betroffenen Zugehörigkeit und Anerkennung außerhalb demokratischer Räume suchen.
Extremistische Ideologien bieten dabei vermeintlich einfache Antworten: auf erfahrenes Leid, auf empfundene Ungleichheit – und auf die Suche nach Identität. Nicht selten sind es gerade Narrative, die antiwestlich, antisemitisch oder verschwörungsideologisch geprägt sind, in denen sich Betroffene wiederfinden.
Jugend im Spannungsfeld: Polarisierung und Systemkritik
Besonders bei Jugendlichen zeigen sich diese Dynamiken deutlich. Die SINUS-Jugendstudie 2024 dokumentiert eine wachsende Sensibilität für soziale Gerechtigkeit – bei gleichzeitiger Polarisierung. Während ein Teil der Jugendlichen sich klar antidiskriminierend positioniert, erlebt ein anderer Teil Resignation oder – seltener – Radikalisierung. Wer sich wiederholt diskriminiert fühlt, berichtet häufiger über das Gefühl, „nicht gehört“ zu werden – insbesondere in Schule und Ausbildung.
Für die Demokratiebildung und Prävention heißt das: Angebote müssen nicht nur kognitiv ansetzen, sondern auch biografische, emotionale und soziale Räume ernst nehmen.
Gesundheitswesen, Arbeitswelt und institutionelles Vertrauen
Ein unterschätzter Raum ist das Gesundheitswesen. Die ADS-Studie „Diagnose Diskriminierung“ (03/2024) zeigt, dass sprachliche Barrieren, rassistische Vorannahmen oder institutionelle Blindstellen alltäglich sind. Wer hier systematisch Ausgrenzung erlebt, verliert Vertrauen – mit Folgen für gesellschaftliche Teilhabe und das Verhältnis zum Staat.
Auch im Arbeitsleben ist Diskriminierung präsent. Der Fachbeitrag „Zwischen Theorie und Praxis: Wie kann diskriminierungssensible(re) Personalentwicklung gelingen?“ (SpringerOpen, 01/2025) verdeutlicht: Antidiskriminierende Strukturen im Beruf sind keine freiwillige Kür, sondern ein Schlüssel zur Prävention.
Schlussfolgerung: Diskriminierung als Prüfstein für Demokratie
Diskriminierung allein erklärt keine Radikalisierung. Aber sie ist ein Verstärker, ein Risikofaktor – vor allem, wenn sie institutionell verankert und emotional unbearbeitbar bleibt. Für unsere Fachpraxis bedeutet das:
- Wir müssen Diskriminierung systematisch in unsere Risikobewertungen einbeziehen.
- Unsere Angebote müssen traumasensibel, biografieorientiert und partizipativ gestaltet sein.
- Institutionen in Bildung, Gesundheit und Arbeit brauchen diskriminierungssensible Fortbildungen – im engen Austausch mit der Extremismusdistanzierung.
Diskriminierung ist kein Randthema. Sie ist zentral. Die aktuellen Studien zeigen: Wir müssen genauer hinsehen – auf verletzte Subjekte, strukturelle Machtverhältnisse und institutionelle Verantwortung. Und wir müssen uns selbst befragen: nach unserer Sprache, unserer Haltung, unserer Rolle.
Nur dann gelingt es, Brücken zu bauen – zwischen Ausgrenzung und Zugehörigkeit, zwischen Wut und Würde.