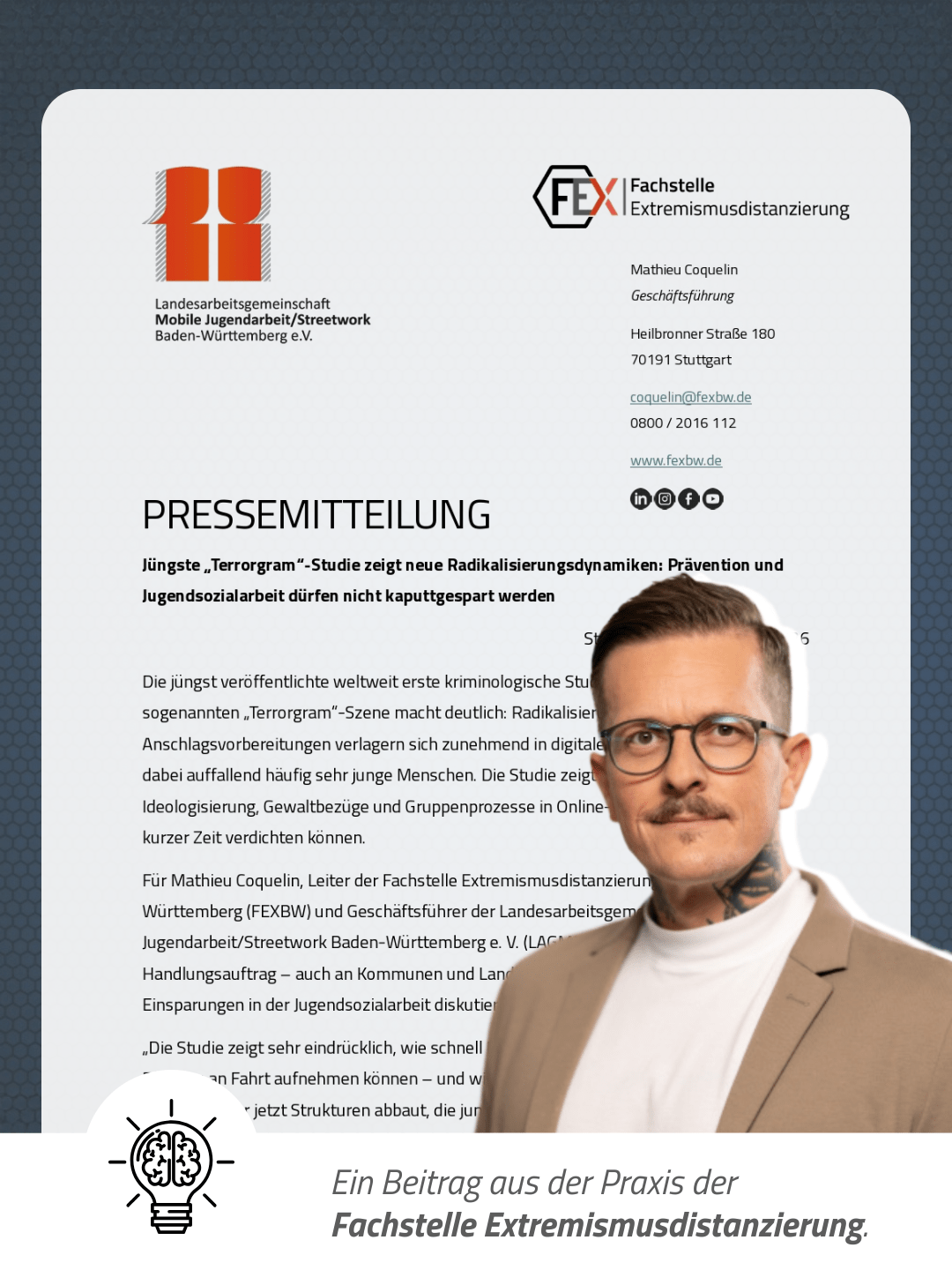Dankbarkeit, Zuversicht und Zuhören – warum Haltung präventiv wirkt
Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich.
Dieser Satz klingt zunächst wie eine Lebensweisheit, vielleicht sogar wie ein Trostpflaster für schwierige Zeiten. Und doch lohnt es sich, ihn gerade jetzt ernst zu nehmen. Nicht als Kalenderspruch, sondern als Haltung.
Die Weihnachtszeit ist einer der wenigen gesellschaftlich akzeptierten Momente, in denen man innehalten darf. In denen man Bilanz zieht, ohne sofort Lösungen präsentieren zu müssen. In denen Wünsche erlaubt sind, auch dann, wenn sie sich nicht unmittelbar einlösen lassen. Gerade deshalb eignet sich dieser Moment für eine Frage, die in politischen und fachlichen Debatten oft zu kurz kommt: Was hält uns eigentlich zusammen, wenn Zuversicht knapp wird?
Denn es wäre unredlich zu behaupten, die Zeiten seien rosig. Unsicherheit prägt viele Lebensbereiche. Zukunft wird häufig als Problemraum verhandelt, weniger als gemeinsames Projekt. Gleichzeitig zeigt sich etwas Paradoxes: Viele Menschen blicken gar nicht so pessimistisch auf ihr eigenes Leben – wohl aber auf die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt. Diese Verschiebung ist kein Randphänomen. Sie verändert, wie wir über Politik sprechen, wie wir Konflikte deuten und wie anschlussfähig einfache Erklärungen werden.
In diesem Spannungsfeld wirkt der Wunsch nach Zuversicht schnell naiv. Als würde man Schwierigkeiten ausblenden oder Probleme kleinreden. Doch genau hier lohnt ein genauerer Blick – auch aus der Perspektive der Radikalisierungsforschung. Denn Zuversicht ist dort kein Wohlfühlbegriff. Sie ist eine Ressource. Eine Voraussetzung dafür, dass Menschen sich nicht aus dem Gemeinsamen zurückziehen, sondern sich weiterhin als Teil eines größeren Zusammenhangs erleben können.
Dankbarkeit meint in diesem Kontext nicht Zufriedenheit mit dem Status quo. Sie meint auch nicht, Kritik zu unterlassen oder Ungerechtigkeiten zu akzeptieren. Dankbarkeit beschreibt vielmehr die Fähigkeit, das wahrzunehmen, was trotz aller Brüche trägt. Institutionen, Beziehungen, Verfahren, Menschen. Dinge, die nicht selbstverständlich sind – und die genau dann an Bedeutung gewinnen, wenn sie unter Druck geraten.
Vielleicht ist das der eigentliche Grund, warum dieser Gedanke so gut in die Weihnachtszeit passt. Nicht, weil er einfache Antworten liefert. Sondern weil er daran erinnert, dass kollektive Zuversicht nicht aus guten Umständen entsteht, sondern aus einer gemeinsamen Haltung. Und dass diese Haltung erlernbar, einübbar und immer wieder neu zu verhandeln ist.
Warum kollektive Zuversicht präventiv wirkt
Ein Blick aus der Radikalisierungsforschung
In der Radikalisierungsforschung spielt die Frage nach Unzufriedenheit seit jeher eine zentrale Rolle. Allerdings geht es dabei selten um objektive Benachteiligung oder messbare Notlagen. Viel häufiger geht es um Wahrnehmungen. Um Vergleiche. Um das Gefühl, dass sich etwas verschiebt – nicht unbedingt im eigenen Leben, aber im größeren Ganzen.
Ein etabliertes Erklärungsmodell ist das der relativen Deprivation. Es beschreibt jene Spannungen, die entstehen, wenn Menschen das, was sie erwarten oder für legitim erreichbar halten, zunehmend als bedroht oder unerreichbar wahrnehmen. Entscheidend ist dabei nicht, ob diese Einschätzung „objektiv stimmt“. Entscheidend ist, dass sie erlebt wird. Und dass sie in Deutungsangebote eingebettet ist, die erklären, warum diese Diskrepanz existiert – und wer dafür verantwortlich gemacht werden kann.
Spannend ist, dass aktuelle Studien und Befragungen ein scheinbares Paradox zeigen: Viele Menschen blicken durchaus zuversichtlich auf ihre persönliche Zukunft. Gleichzeitig nimmt der Pessimismus gegenüber der gesellschaftlichen Entwicklung zu. Die eigene Biografie erscheint gestaltbar, die kollektive Zukunft dagegen fragil. Genau in dieser Lücke entsteht ein Resonanzraum für einfache Erzählungen. Für Narrative, die komplexe Entwicklungen personalisieren, Konflikte zuspitzen und Zugehörigkeit über Abgrenzung herstellen.
Radikalisierung speist sich in solchen Momenten weniger aus individueller Verzweiflung als aus kollektiver Kränkung. Aus dem Gefühl, dass „wir“ verlieren, während andere profitieren. Dass Regeln nicht mehr gelten. Dass das Gemeinsame erodiert. Ideologische Angebote knüpfen genau hier an. Sie versprechen Ordnung, Klarheit und Handlungsfähigkeit – oft um den Preis von Ausgrenzung und Vereinfachung.
Vor diesem Hintergrund bekommt Zuversicht eine andere Bedeutung. Sie ist kein emotionaler Luxus und kein naiver Gegenentwurf zur Kritik. Kollektive Zuversicht wirkt präventiv, weil sie Menschen im Gemeinsamen hält. Weil sie die Vorstellung stärkt, dass gesellschaftliche Probleme verhandelbar sind – und nicht nur durch Rückzug oder Radikalisierung beantwortet werden können.
Dabei geht es nicht um Optimismus um jeden Preis. Sondern um die Fähigkeit, Ambivalenz auszuhalten. Zu akzeptieren, dass Unsicherheit Teil gesellschaftlicher Transformation ist, ohne sie sofort in Schuldzuweisungen zu übersetzen. Präventiv wirksam wird Zuversicht dort, wo Menschen sich weiterhin als Teil eines sozialen Zusammenhangs erleben, der Konflikte bearbeiten kann – statt sie zu externalisieren.
Diese Perspektive verschiebt den Blick. Weg von der Frage, warum Menschen „falsch denken“. Hin zu der Frage, unter welchen Bedingungen demokratische Deutungsräume stabil bleiben. Und genau hier schließt sich der Kreis zur praktischen Präventionsarbeit: Wer verstehen will, wie Radikalisierung entsteht, muss sich mit den Momenten befassen, in denen kollektive Zuversicht brüchig wird – und mit den Ressourcen, die ihr entgegenwirken können.
Vom Aktionismus zur Anamnese
Zehn Jahre Lernprozess in der Präventionspraxis
Wer länger in der Radikalisierungsprävention arbeitet, kennt dieses Muster gut. Irgendwo wird etwas beobachtet. Eine irritierende Aussage, ein auffälliges Symbol, ein eskalierendes Gespräch. Der Handlungsdruck steigt. Also wird reagiert. Ein Workshop wird organisiert, ein Projekttag angesetzt, ein externes Angebot eingekauft. Am Ende gibt es ein Programm, eine Maßnahme, manchmal sogar ein gutes Gefühl – und häufig einen Haken hinter dem Vorgang.
Diese Logik ist nachvollziehbar. Sie erzeugt Sichtbarkeit, Aktivität und das beruhigende Gefühl, etwas getan zu haben. Gleichzeitig hat sie sich in der Praxis immer wieder als problematisch erwiesen. Nicht, weil Workshops oder Bildungsangebote wirkungslos wären. Sondern weil sie oft an die Stelle von Analyse treten. Beobachtung ersetzt Verstehen. Intervention ersetzt Anamnese.
Genau an diesem Punkt setzte ein zentraler Lernprozess der letzten zehn Jahre an. Die Erfahrung, dass Radikalisierung nicht dort entsteht, wo wir sie zuerst sehen, sondern dort, wo sich Unzufriedenheit, Unsicherheit und Deutungslücken verdichten. Und dass es wenig sinnvoll ist, mit fertigen Antworten zu arbeiten, wenn die eigentlichen Fragen noch gar nicht gestellt wurden.
Vor diesem Hintergrund entstand früh der Versuch, ein Instrument zu entwickeln, das genau diese Lücke schließt: ein Anamnese-Instrument für die soziale Arbeit im Kontext der Radikalisierungsprävention. Nicht als Diagnosetool im klinischen Sinne, sondern als strukturierte Denk- und Arbeitshilfe. Ein Rahmen, der Fachkräften hilft, systematisch zu erfassen, wo jemand gerade steht, welche Spannungen wirksam sind und welche Deutungsangebote anschlussfähig werden könnten.
Über mehrere Jahre hinweg wurde dieses Instrument im Rahmen eines Forschungsprojekts gemeinsam mit Studierenden erprobt. Fünf Jahre lang haben sie es auf unterschiedliche Fallkonstellationen angewendet, reflektiert und im Rahmen von Studienarbeiten ausgewertet. Das Ergebnis war bemerkenswert klar: Der größte Mehrwert lag nicht in der Kategorisierung von Fällen, sondern in der Entlastung des professionellen Handelns. Die Anamnese schuf Ordnung in komplexen Situationen. Sie half, vorschnelle Zuschreibungen zu vermeiden und die eigene Wahrnehmung nicht mit der Realität des Gegenübers zu verwechseln.
Vor allem aber machte sie sichtbar, was im hektischen Arbeitsalltag leicht verloren geht: dass Radikalisierungsdynamiken selten isoliert entstehen. Sie sind eingebettet in biografische Brüche, soziale Verwerfungen, ökonomische Unsicherheiten und kommunikative Sackgassen. Wer diese Ebenen systematisch in den Blick nimmt, arbeitet nicht langsamer – sondern präziser.
In diesem Sinne war die Entwicklung der Anamnese kein methodischer Selbstzweck. Sie war eine Antwort auf eine wiederkehrende Erfahrung: Wirksame Prävention beginnt nicht mit der Maßnahme, sondern mit dem genauen Hinschauen. Und genau hier öffnet sich der Raum für einen anderen Umgang mit Unzufriedenheit – nicht als Defizit, das behoben werden muss, sondern als Signal, das verstanden werden will.
Wenn Argumente nicht mehr helfen
Ein Beispiel aus der frühen Pandemie
Zu Beginn der Pandemie war vieles offen. Nicht nur virologisch oder politisch, sondern auch fachlich. Die bekannten Modelle der Radikalisierungsforschung bezogen sich auf andere Kontexte: politische Ideologien, organisierte Szenen, klar benennbare Narrative. Mit dem raschen Aufkommen von Verschwörungserzählungen stellte sich eine neue Frage: Lassen sich diese theoretischen Zugänge überhaupt auf eine Situation anwenden, in der Unsicherheit zum gesellschaftlichen Normalzustand geworden war?
In dieser Phase kam ein Studierender mit einer eher beiläufigen, aber entscheidenden Frage: Ob man das Anamnese-Instrument auch auf einen solchen Kontext anwenden könne. Nicht im professionellen Setting, sondern auf eine Situation im eigenen Umfeld. Es ging um seine Tante, die sich im Laufe der ersten Monate zunehmend in verschwörungstheoretische Erzählungen zurückgezogen hatte.
Die Familie hatte versucht, dem kognitiv zu begegnen. Mit Argumenten, Fakten, Studien. Diskussionen verlagerten sich in WhatsApp-Gruppen, setzten sich bei Familientreffen fort und kreisten immer stärker um dieselben Inhalte. Je mehr widersprochen wurde, desto fester schien sich die Überzeugung zu verankern. Gespräche wurden anstrengender, Beziehungen brüchiger, und das eigentliche Miteinander trat zunehmend in den Hintergrund.
Die Anwendung der Anamnese verschob den Blick. Statt weiter über Inhalte zu streiten, wurde gefragt: Was ist gerade eigentlich los? Wo steht diese Person in ihrem Leben? Welche Sorgen, welche Brüche, welche Verlusterfahrungen sind in dieser Situation wirksam? Und warum könnten gerade diese Erzählungen anschlussfähig geworden sein?
Relativ schnell traten andere Ebenen in den Vordergrund. Finanzielle Unsicherheit, ausgelöst durch die Pandemie. Eine bereits zuvor bestehende Nähe zu bestimmten Online-Diskursräumen. Das Gefühl, Kontrolle zu verlieren – nicht nur über politische Entscheidungen, sondern über den eigenen Alltag. Hinzu kam eine Dynamik, die sich im familiären Umgang selbst verstärkt hatte: Die permanente kognitive Konfrontation ließ kaum noch andere Kommunikationsräume zu. Alles wurde politisch, alles wurde argumentativ, alles wurde zu einer Frage von richtig oder falsch.
Erst als sich der Umgang veränderte, öffneten sich neue Handlungsspielräume. Die Familie begann, andere Ebenen wieder bewusst zu besetzen. Unterstützung im Alltag, Gespräche jenseits der Pandemie, gemeinsame Aktivitäten, bei denen nicht diskutiert werden musste. Finanzielle Sorgen wurden ernst genommen und praktisch adressiert. Nicht, um Überzeugungen zu bestätigen – sondern um die Situation zu stabilisieren, aus der heraus sie entstanden waren.
Was sich dadurch veränderte, war weniger der Inhalt der Überzeugungen als ihre Funktion. Die Notwendigkeit, sich permanent in verschwörungstheoretischen Kontexten zu bewegen, verlor an Dringlichkeit. Das Thema verschwand nicht. Aber es bestimmte nicht mehr jede Begegnung. Der Student beschrieb rückblickend, dass sich vor allem die Familie wieder handlungsfähiger fühlte. Nicht, weil sie „gewonnen“ hatte, sondern weil sie wieder Beziehung gestalten konnte.
Mehr lässt sich aus diesem Beispiel nicht pauschal ableiten – und genau darin liegt vielleicht seine wichtigste Erkenntnis. Nicht jede Dynamik lässt sich auflösen. Aber viele lassen sich verschieben, wenn man bereit ist, den Blick von der reinen Inhaltsebene zu lösen und die Bedingungen ernst zu nehmen, unter denen bestimmte Deutungen Halt geben.
Was Anamnese sichtbar macht
Und warum Zuhören oft der erste wirksame Schritt ist
Das Beispiel aus der Pandemie macht deutlich, worin die eigentliche Stärke einer anamnesegeleiteten Herangehensweise liegt. Sie liefert keine schnellen Lösungen und keine einfachen Antworten. Aber sie verändert den Rahmen, in dem Probleme verhandelt werden. Und genau darin liegt ihre präventive Wirkung.
Anamnese bedeutet, die Situation eines Menschen ernst zu nehmen, ohne jede geäußerte Position zu übernehmen. Sie trennt Wahrnehmung von Bewertung. Nicht alles, was gesagt wird, ist akzeptabel. Aber vieles von dem, was gesagt wird, verweist auf eine Lage, die verstanden werden muss, wenn Veränderung möglich werden soll. Diese Unterscheidung ist zentral – fachlich wie demokratisch.
In der Praxis zeigte sich immer wieder: Unzufriedenheit ist selten eindimensional. Sie speist sich aus ökonomischen Sorgen, biografischen Brüchen, sozialen Vergleichen, digitalen Resonanzräumen. Wer ausschließlich auf der kognitiven Ebene reagiert, verstärkt häufig genau jene Dynamiken, die er eigentlich unterbrechen möchte. Argumente prallen nicht deshalb ab, weil Menschen irrational wären, sondern weil sie an einer anderen Stelle Halt suchen.
Das Anamnese-Instrument hilft, diesen Halt sichtbar zu machen. Es lenkt den Blick auf Auslöser statt auf Symptome, auf Funktionen statt auf Inhalte. Und es schafft etwas, das in polarisierten Situationen schnell verloren geht: das Signal, gesehen zu werden. Nicht als Zustimmung. Sondern als Anerkennung der Tatsache, dass hier ein reales Problem erlebt wird.
In vielen Fällen war genau das bereits ein Wendepunkt. Nicht im Sinne eines schnellen Meinungswandels, sondern als Wiedergewinn von Handlungsspielräumen. Gespräche wurden wieder möglich, Beziehungen weniger konflikthaft, Interventionen gezielter. Prävention zeigte sich hier nicht als großes Programm, sondern als präzise, zugewandte Arbeit am Einzelfall.
Rückblickend war das vielleicht eine der wichtigsten Erkenntnisse der letzten Jahre: Radikalisierungsprävention ist nicht in erster Linie die Arbeit gegen Überzeugungen. Sie ist die Arbeit an Bedingungen. An den Kontexten, in denen Menschen sich zurückziehen oder andocken. Und an den Räumen, in denen sie sich wieder als Teil eines tragfähigen Miteinanders erleben können.
Ein leiser Gedanke zum Jahresende
Vielleicht ist das eine gute Perspektive für den Abschluss dieser Reihe. Dankbarkeit nicht als Gefühl, das sich einstellt, wenn alles gut läuft. Sondern als bewusster Blick auf das, was trotz Unsicherheit trägt. Beziehungen. Gesprächsräume. Die Möglichkeit, einander zuzuhören, ohne alles sofort lösen zu müssen.
Gerade in Zeiten, in denen viele Gespräche anstrengend geworden sind – beruflich wie privat –, kann es entlastend sein, den Anspruch zu senken. Nicht jedes Thema muss entschieden werden. Nicht jede Differenz überwunden. Manchmal reicht es, einem Gespräch einen anderen Rahmen zu geben.
Das ist kein Versprechen auf einfache Lösungen. Aber es ist eine Einladung, Zuversicht nicht als Ergebnis zu verstehen, sondern als Haltung. Eine Haltung, die Menschen im Gespräch hält – und Gesellschaften beweglich.
Mit diesem Gedanken endet diese Advents-Newsletter-Reihe. Ich wünsche Ihnen und euch ruhige Feiertage, Zeit zum Durchatmen – und Begegnungen, die nicht alles klären müssen, um gut zu sein. Wir lesen uns im nächsten Jahr.