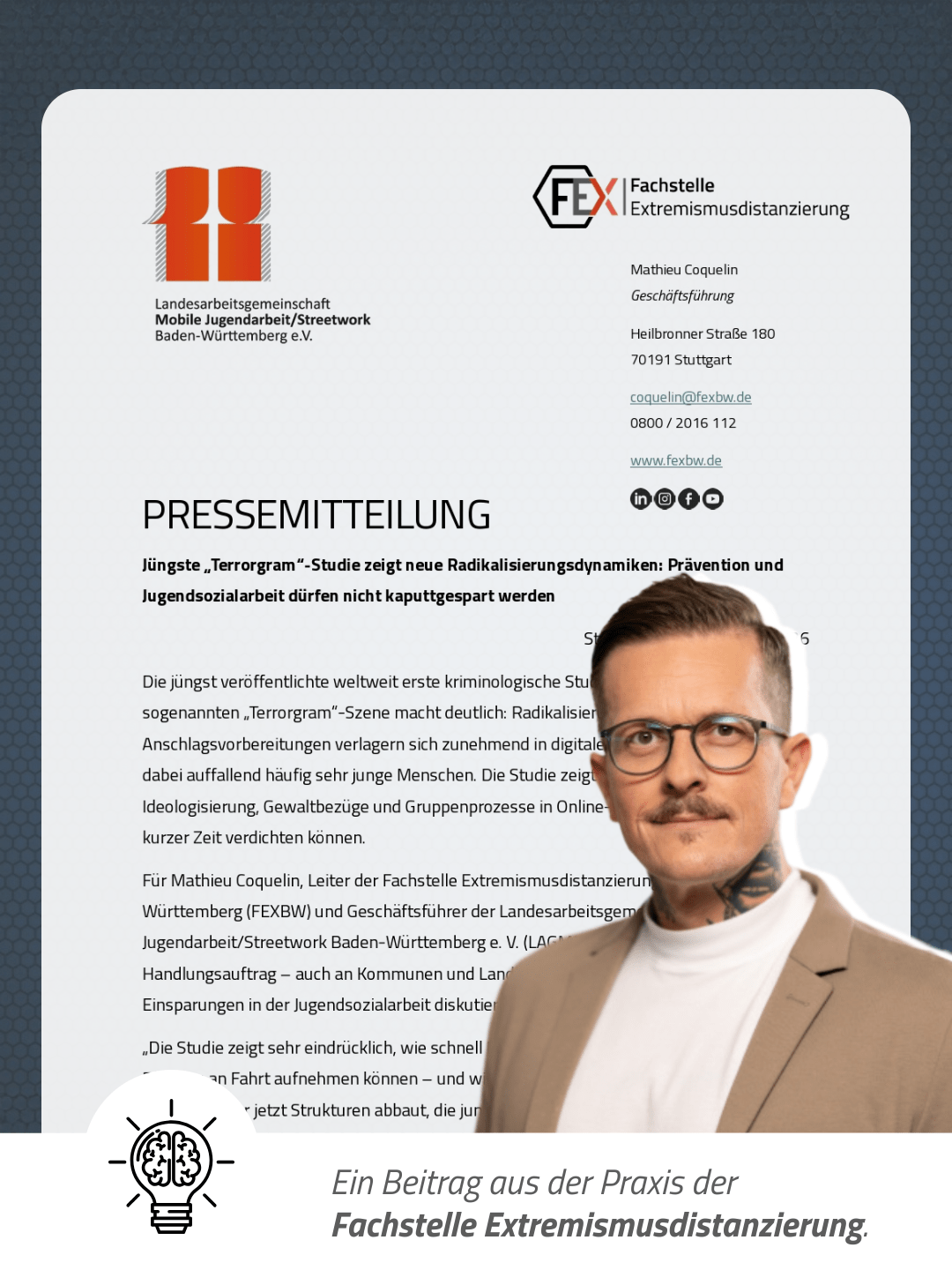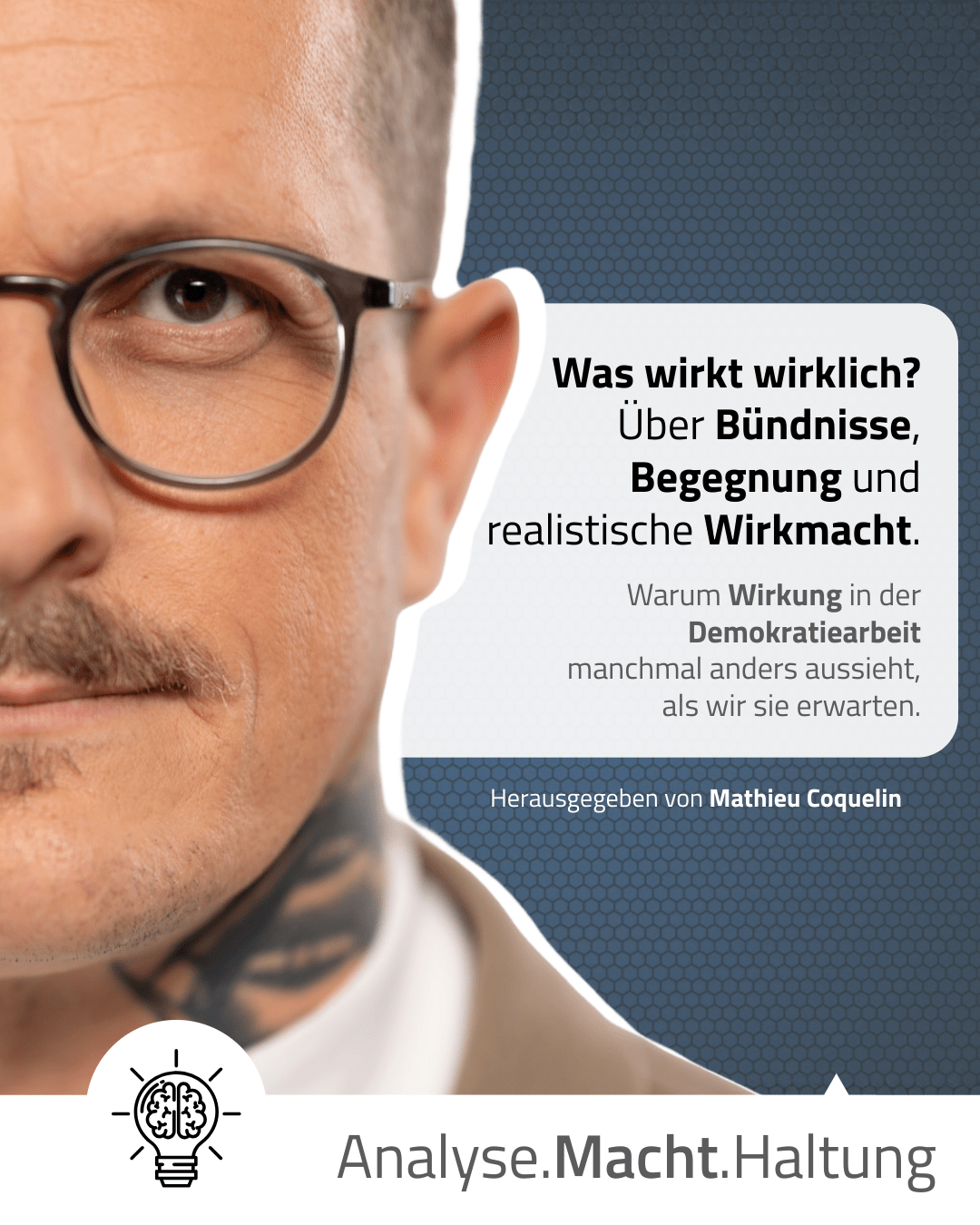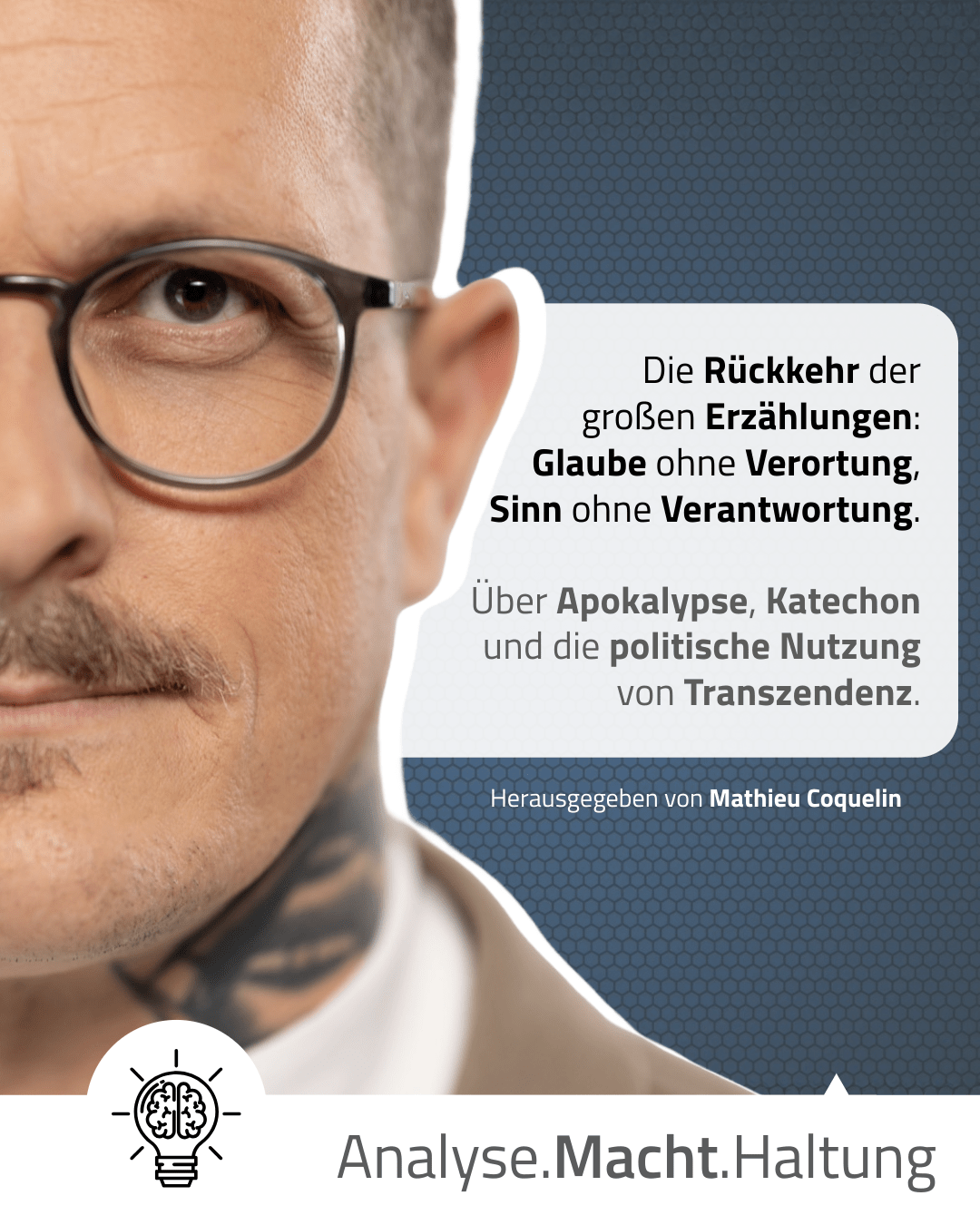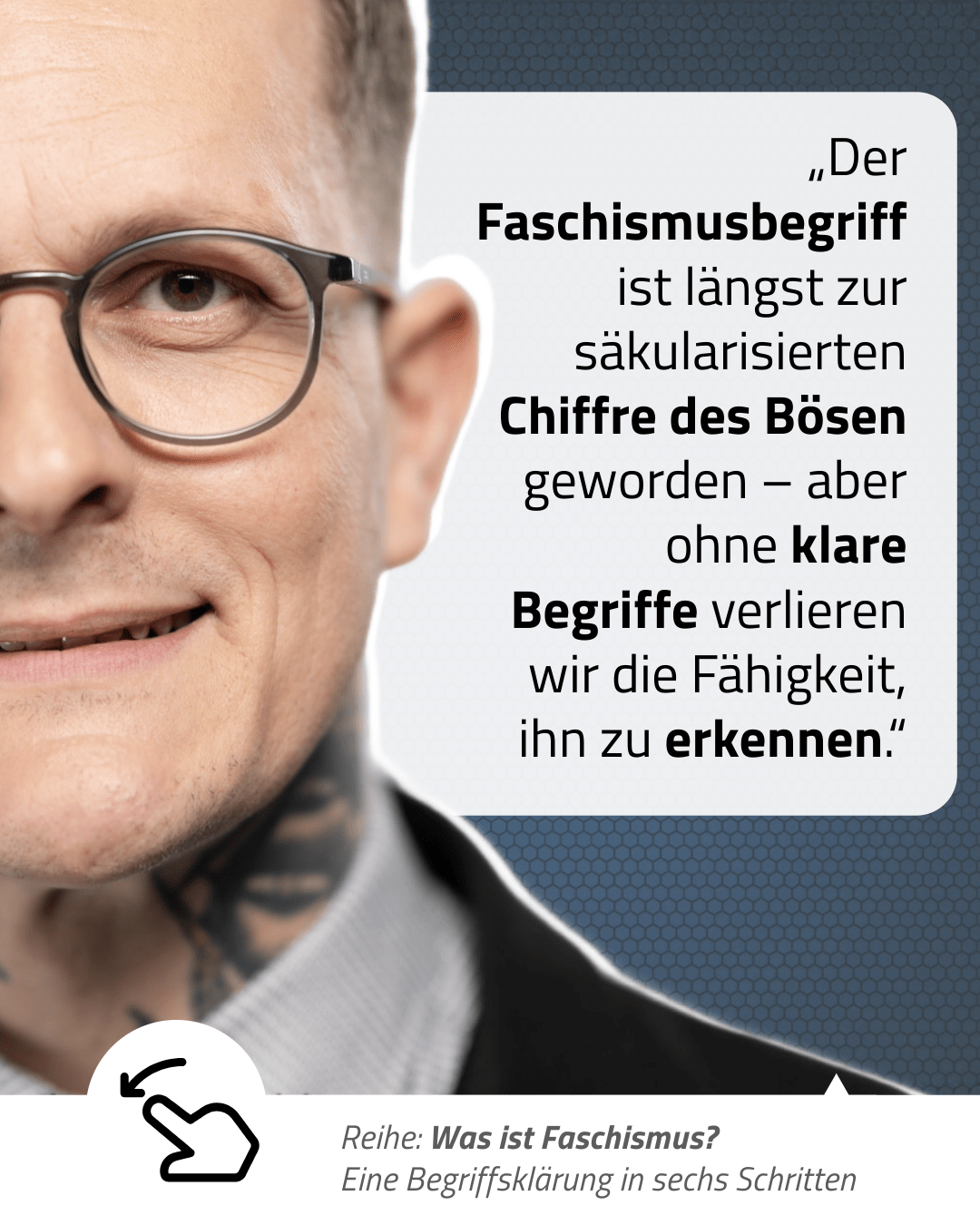
Was ist Faschismus? Definitionen, historische Beispiele & politische Bildung im Überblick
Sechs Zugänge zur Begriffsklärung in Zeiten der Unschärfe
Warum wir über Faschismus sprechen müssen
Der Begriff „Faschismus“ ist längst kein exklusiv historischer Begriff mehr. Er hat seinen Weg in die Alltagsrhetorik, die sozialen Netzwerke und politische Debatten gefunden – häufig jedoch entkoppelt von analytischer Präzision. Kaum ein politischer Streit, der nicht irgendwo den Vorwurf faschistischer Tendenzen hervorruft. Von „Klimafaschisten“ ist die Rede, wenn radikale Formen des Protests auf Unmut stoßen. Der Begriff „Linksfaschismus“ wird verwendet, wenn über Enteignungsforderungen oder Protestaktionen gegen Rechts gestritten wird. Und auch im Umgang mit Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung wurde der Faschismusbegriff bemüht – nicht selten im Kontext von Ausgangsbeschränkungen oder Impfvorgaben.
Diese Beispiele zeigen: Der Begriff ist wirkmächtig, aber gefährdet, zur bloßen Chiffre für „das Böse“ zu verkommen. Er wird immer dann genutzt, wenn etwas als übergriffig, repressiv oder systemisch unangenehm empfunden wird. Dadurch verliert er jedoch an Klarheit, und das hat Konsequenzen. Denn wenn „alles irgendwie Faschismus“ ist, dann ist am Ende nichts mehr wirklich Faschismus. Die Folge ist nicht nur eine semantische Unschärfe – sondern eine historische und politische Entwertung dessen, was dieser Begriff ursprünglich bezeichnen sollte.
Besonders heikel wird es, wenn wir es versäumen, diese Entwicklungen kritisch zu begleiten. Denn mit der Popularisierung eines Begriffs kommt auch die Vielstimmigkeit der Deutung – und selten sind darunter wissenschaftlich fundierte. Die Wissenschaft selbst trägt dafür eine Mitverantwortung: Sie ist oft zu langsam, zu verklausuliert oder zu wenig sichtbar, um im öffentlichen Diskurs Orientierung zu bieten.
Gerade deshalb haben wir mit dieser Blogreihe das Ziel verfolgt, sechs einflussreiche, aber sehr unterschiedlich gelagerte Perspektiven auf Faschismus zusammenzubringen. Es geht nicht um Eindeutigkeit, sondern um die Fähigkeit zur Differenzierung – und um die Einsicht, dass der Begriff „Faschismus“ keine abschließbare Definition zulässt, aber sehr wohl eine strukturelle Lesbarkeit.
Der Blog richtet sich dabei nicht nur an ein akademisches Publikum. Vielmehr geht es um Anschlussfähigkeit: an politische Bildner:innen, Multiplikator:innen, Lehrkräfte, Fachkräfte der Jugend- und Sozialarbeit – und letztlich an alle, die den Begriff „Faschismus“ in ihrer Arbeit oder Auseinandersetzung brauchen, aber nicht missbrauchen wollen.
1. Roger Griffin: Faschismus als nationale Wiedergeburt
Wer Faschismus verstehen will, muss sich von der Vorstellung verabschieden, es handele sich um ein rein rückwärtsgewandtes Projekt. Der britische Historiker Roger Griffin prägte dafür einen Begriff, der heute zu den einflussreichsten Faschismusdefinitionen gehört: palingenetischer Ultranationalismus. Gemeint ist damit der Versuch einer „nationalen Wiedergeburt“ nach einer Phase des empfundenen Verfalls.
Diese Wiedergeburtsfantasie ist kein restauratives Zurück zur Vergangenheit, sondern ein revolutionäres Nach-vorne: eine utopische Vision eines „reinen“, „gesunden“ Nationalkörpers, der durch Selbstopfer, Ausschluss und Gewalt verwirklicht werden soll. Faschismus ist also keineswegs ideenleer – er ist voller Sinnangebote. Und das macht ihn gefährlich.
Gerade in politischen Umfeldern, in denen komplexe Problemlagen vorherrschen und politische Erzählungen diffus oder schwer greifbar bleiben, entfaltet diese Logik eine besondere Wirkung. Denn während demokratische Visionen häufig mit Widersprüchen, offenen Fragen und Zumutungen verbunden sind, bietet die faschistische Ideologie einfache Bilder: Reinheit statt Widerspruch, Ordnung statt Ambivalenz, Identität statt Aushandlung. Sie verspricht emotionale Klarheit – nicht trotz, sondern wegen ihrer Exklusion.
In der pädagogischen Praxis birgt Griffins Perspektive einen wichtigen Lernmoment: Faschismus ist nicht das Andere, das ganz Fremde, das sich aus archaischen Restbeständen speist. Er ist anschlussfähig, gerade weil er modernistisch ist – weil er Veränderung verspricht, Mobilisierung erzeugt und Sinn stiftet. Wer das begreift, kann aus der moralischen Abwehrhaltung in eine echte Auseinandersetzung kommen. Und genau das ist der erste Schritt zu wirksamer politischer Bildung.
2. Robert Paxton: Faschismus als politischer Prozess
Während viele Faschismustheorien versuchen, das Wesen faschistischer Ideologie zu definieren, wählt der US-amerikanische Historiker Robert O. Paxton einen anderen Zugang: Er rückt das Handeln in den Mittelpunkt. Ihn interessiert nicht primär, was Faschisten denken – sondern was sie tun. Und vor allem: Wann und wie sich eine faschistische Bewegung in der Gesellschaft verankert.
Paxton beschreibt Faschismus als Prozess in fünf Phasen:
- Intellektuelle Artikulation
In Zeiten gesellschaftlicher Krisen entsteht eine erste ideologische Erzählung – häufig verbunden mit der Vorstellung eines „verfallenden Volkskörpers“ und der Notwendigkeit eines nationalen Erwachens. - Mobilisierung:
Die Erzählung wird politisch organisiert – in Form von Parteien, Bewegungen, Milizen oder Netzwerken. Die Sprache radikalisiert sich, Gegner:innen werden systematisch delegitimiert. - Machteroberung:
In einer Phase politischer Instabilität gelingt der Schritt von der Straße in die Institutionen. Demokratien helfen oft bei ihrer eigenen Demontage. - Machtsicherung:
Institutionen werden gleichgeschaltet, Gewalt wird legalisiert, Opposition ausgeschaltet. - Radikalisierung:
Gewalt gegen äußere und innere Feinde wird zur strukturellen Logik des Systems. Oft verbunden mit Krieg, Terror oder Genozid.
Paxtons Modell ist deshalb so wertvoll, weil es uns einen Rahmen gibt, Faschismus nicht als plötzliches Ereignis, sondern als dynamischen Prozess zu denken. Es erlaubt, Entwicklungen frühzeitig zu beobachten, ohne dabei alles sofort „faschistisch“ nennen zu müssen. So wird es möglich, mit Begriffsschärfe und historischer Tiefe über demokratiegefährdende Entwicklungen zu sprechen – und nicht nur zu alarmieren.
Für die politische Bildung ist dieser Prozessgedanke ein zentraler Baustein:
- Er eignet sich hervorragend für Fallanalysen
(z. B. „Wo stehen wir in Phase X?“), - macht politische Prozesse greifbar,
- und erlaubt, die Grenzen von Meinungsfreiheit, Protest und autoritärer Normalisierung zu reflektieren.
Vor allem aber macht Paxton deutlich: Faschismus ist nicht das Ergebnis einer Verschwörung – er ist das Resultat eines schleichenden Prozesses gesellschaftlicher Umdeutung. Und genau deshalb braucht es wache Begriffe, um ihn zu erkennen.
3. Umberto Eco: Der Ur-Faschismus als Struktur
Der italienische Schriftsteller, Semiotiker und Intellektuelle Umberto Eco veröffentlichte 1995 einen Text mit enormer Nachwirkung: „Ur-Fascism“, auf Deutsch oft übersetzt als „Der ewige Faschismus“. Darin beschreibt er nicht ein bestimmtes Regime oder eine abgeschlossene Ideologie – sondern ein Muster, das sich durch Sprache, Kultur und Politik ziehen kann, ohne gleich in eine Diktatur zu münden.
Seine zentrale These: Faschismus ist kein System, sondern ein Set von wiederkehrenden Elementen, die sich in unterschiedlichen historischen und kulturellen Kontexten kombinieren lassen. Er identifiziert 14 solcher Merkmale:
- Kult der Tradition
Wahrheit liegt in einer idealisierten Vergangenheit. - Ablehnung der Moderne
Rationalismus und Fortschritt gelten als Verfall. - Kult des Handelns um des Handelns willen
Aktion ist besser als Reflexion. - Ablehnung kritischen Denkens
Kritik wird als Verrat diffamiert. - Angst vor Differenz
Vielfalt gilt als Bedrohung, nicht als Ressource. - Appell an eine frustrierte Mittelschicht
sozialer Statusverlust als Mobilisierungskraft. - Obsession mit Verschwörungen
Eine geheime Elite bedroht das Volk. - Feindbildkult
Identität wird durch Hass auf das Andere erzeugt. - Gleichzeitiger Elitismus und Populismus
Das „wahre Volk“ vs. „korrupte Eliten“. - Leben als permanenter Krieg
Frieden bedeutet Dekadenz. - Verachtung der Schwäche
Empathie wird diskreditiert. - Kult des Heldentums und Todes
Märtyrertum als Ideal. - Machismo und Waffenkult
männlich konnotierte Gewaltästhetik. - Manipulation der Sprache („Newspeak“)
Sprache wird simplifiziert und propagandistisch aufgeladen.
Eco warnt: Es ist nicht notwendig, dass alle 14 Merkmale gleichzeitig auftreten – aber je mehr davon in einer Gesellschaft sichtbar werden, desto stärker die faschistoide Tendenz. Und gerade, weil viele dieser Merkmale subtil, rhetorisch oder kulturell wirken, sind sie besonders schwer zu identifizieren – und leicht zu verharmlosen.
In der politischen Bildung liegt hier ein enormes Potenzial:
- Ecos Liste ermöglicht es, aktuelle Phänomene zu analysieren, ohne sofort totalitäre Gleichsetzungen zu bemühen.
- Sie funktioniert als Frühwarnsystem, das in der Auseinandersetzung mit Populismus, Identitätspolitiken oder verschwörungsideologischen Milieus eingesetzt werden kann.
- Sie ist zugänglich und diskussionsanregend, auch mit jungen Menschen, z. B. durch Gruppenarbeit, Analyse von Social Media, Wahlkampfmaterialien oder Reden.
Ecos Leistung war es, den Faschismus vom Regime zur Struktur umzudenken – und damit die Deutung nicht nur in Geschichtsbücher, sondern in die Gegenwart zu holen. Diese Perspektive ist unbequem – aber unverzichtbar.
4. Mosse & Sternhell: Ästhetik, Körper und faschistische Ideenwelt
Zwei sehr unterschiedliche, aber sich ergänzende Perspektiven liefern George L. Mosse und Zeev Sternhell. Beide erweitern den analytischen Blick auf Faschismus – über Parteiprogramme, Gewalt und Ideologie hinaus – hin zu Körperbildern, Gefühlsräumen und Deutungskulturen.
George L. Mosse: Der Faschismus als Inszenierung des Körpers
Mosse erkannte früh, dass faschistische Bewegungen nicht allein durch ihre Inhalte wirken, sondern durch Ästhetik, Ritual und Körperpolitik. Ob Aufmärsche, Fackelzüge, Uniformen oder Symbole – sie alle zielten darauf, eine emotionale Gemeinschaft zu erzeugen. Der Körper wurde zum politischen Träger von Disziplin, Kraft und Reinheit. Weiblichkeit wurde abgewertet, Männlichkeit überhöht. Das „gesunde“, leistungsfähige, opferbereite Kollektiv ersetzte das autonome Individuum.
Was Mosse beschreibt, ist der Faschismus als Stilform: Eine emotionale Architektur, die Zugehörigkeit erzeugt – über das, was sichtbar, fühlbar, mitvollziehbar ist. Bis heute wirken diese Muster nach – in rechtsextremer Bildsprache, in Symbolik, in der Heroisierung von Disziplin und Härte.
Zeev Sternhell: Der Faschismus als Idee
Sternhell wiederum stellte klar: Faschismus ist nicht bloß „Reaktion“, sondern eine eigenständige politische Ideologie. Eine Synthese aus Antiliberalismus, Antimarxismus und Nationalismus. Während klassische Konservative auf bestehende Ordnung setzten, strebte der Faschismus nach einer radikal neuen Gesellschaft – nicht trotz, sondern wegen seiner Gewaltbereitschaft.
Das Entscheidende: Sternhells Faschismusbegriff ist intellektuell anschlussfähig. Faschismus ist nicht bloße Barbarei – er ist attraktiv, weil er eine Ordnung verspricht, die jenseits der als dekadent empfundenen Moderne liegt. Er stellt damit eine Alternative in Aussicht – nicht als Ausnahme, sondern als Angebot.
Bildungsrelevanz: Was bedeutet das für uns?
Mosses und Sternhells Ansätze ermöglichen uns eine tiefere Reflexion über die Attraktivität autoritärer Bewegungen – nicht nur bei „den anderen“, sondern auch dort, wo wir vielleicht selbst empfänglich sind für Ordnung, Klarheit, Überlegenheit, Zugehörigkeit.
Für die politische Bildung bedeutet das:
- Die symbolische, emotionale und körperbezogene Dimension des Politischen ernst zu nehmen.
- Zu erkennen, dass autoritäre Bewegungen nicht trotz, sondern wegen ihrer Ästhetik mobilisieren.
- Und den Mut zu haben, über Demokratie nicht nur rational, sondern auch emotional zu sprechen – als Raum für Ambiguität, aber auch für Zugehörigkeit.
5. Timothy Snyder: Schizofaschismus und aktuelle Beispiele
Wenn es um die Frage geht, wie sich faschistische Muster in der Gegenwart beobachten lassen, gehört der Historiker Timothy Snyder zu den präzisesten Stimmen. In seinen Analysen zum Ukrainekrieg, zur Trump-Administration und zur globalen Krise der Demokratie hat er deutlich gemacht: Faschismus tritt heute nicht notwendigerweise in der Uniform des 20. Jahrhunderts auf – aber er folgt strukturell ähnlichen Mustern.
Snyder prägte dafür den Begriff des „Schizofaschismus“: Er bezeichnet Regime, die selbst faschistische Methoden anwenden – aber gleichzeitig andere als Faschisten diffamieren. So etwa in Russland unter Wladimir Putin: Die eigene Kriegsführung wird als „Entnazifizierung“ legitimiert, während gleichzeitig innenpolitisch Medien zerschlagen, Opposition kriminalisiert, Nationalismus und Gewalt ästhetisiert werden. Der Verweis auf ein Feindbild dient nicht der Aufarbeitung – sondern der Legitimation eigener Aggression.
Auch in den USA zeigte sich unter der Trump-Regierung, wie schnell demokratische Institutionen ausgehöhlt werden können: Die Delegitimierung von Wahlen, die Dämonisierung von Journalist:innen, die Normalisierung von Lügen, der Aufbau eines Führerkults – all das sind Elemente, die sich mit Ecos Strukturpunkten und Paxtons Prozessmodell decken.
Snyders Perspektive macht deutlich: Wir müssen nicht abwarten, bis Uniformen marschieren. Faschistische Tendenzen beginnen nicht mit Panzerdivisionen, sondern mit Sprache, Deutungen, Freund-Feind-Mustern. Gerade Demokratien sind anfällig, wenn sie in Unsicherheit geraten, Komplexität nicht moderieren können – und autoritäre Erzählungen die emotional stärkere Sprache anbieten.
Pädagogische Relevanz: Faschismus erkennen lernen – ohne zu überziehen
Snyders Analysen ermöglichen es, gegenwartsbezogene Beispiele mit historischen Kategorien in Beziehung zu setzen – ohne vorschnelle Gleichsetzungen. Für die politische Bildung bedeutet das:
Begriffliche Differenzierung: Nicht jede autoritäre Maßnahme ist faschistisch – aber es gibt Indikatoren, die beunruhigend sind.
Deutungsmuster erkennen: Wer spricht wie über „das Volk“, über „die Elite“, über „Verräter“?
Sprachsensibilität stärken: Politische Kommunikation ist kein Beiwerk – sie ist zentraler Teil autoritärer Strategie.
Historische Analogien kritisch prüfen: Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie bietet Vergleichsräume.
Snyders Arbeit ist ein Appell an die Wachsamkeit – nicht als Panikmache, sondern als demokratische Hygiene. Wer Demokratien liebt, muss lernen, sie sprachlich zu verteidigen.
6. Faschismus überall? Über den Missbrauch und die Inflation des Begriffs
Kaum ein politischer Begriff ist in den letzten Jahren so häufig – und so beliebig – verwendet worden wie „Faschismus“. Er begegnet uns auf Demoschildern, in Kommentarfeldern, in Podcasts, ja sogar in Parlamentsdebatten. Das Problem dabei ist nicht, dass der Begriff verwendet wird – sondern wie.
„Faschismus“ dient heute häufig als moralischer Überwältigungsversuch. Er steht stellvertretend für alles, was als bedrohlich, übergriffig, repressiv oder unmoralisch empfunden wird – sei es die Verkehrspolitik, ein Polizeieinsatz oder ein missliebiger Gesetzesentwurf. Dabei wird selten gefragt: Ist das, was hier kritisiert wird, wirklich faschistisch – oder nur unbequem, autoritär, falsch?
Das Gefährliche daran: Wer den Begriff inflationär verwendet, schwächt seine analytische Kraft. Faschismus wird zur Leerformel – eine Projektionsfläche für alles Unerwünschte. Historisch betrachtet ist das fatal, denn es nimmt uns die Fähigkeit, reale faschistische Bedrohungen zu erkennen. Und es öffnet Tür und Tor für Relativierung.
Bildungsrelevanz: Sprache als Verantwortung
In der politischen Bildung ergibt sich daraus eine doppelte Aufgabe:
- Sensibilisierung für begriffliche Genauigkeit:
Begriffe sind Werkzeuge – wenn wir sie stumpf benutzen, verlieren wir ihre Funktion. Es geht nicht darum, den Begriff „Faschismus“ zu tabuisieren, sondern ihn kontextsensibel einzusetzen. - Reflexion des eigenen Sprachgebrauchs:
Viele Menschen – auch politisch engagierte – haben selbst schon einmal „faschistisch“ gesagt, wenn sie „autoritär“, „ungerecht“ oder „einschüchternd“ meinten. Das ist verständlich – aber nicht unproblematisch. Reflexion heißt nicht Entwertung, sondern Verantwortung. - Den Unterschied erklären können:
Zwischen einem repressiven Gesetz und einer faschistischen Staatsideologie liegen Welten. Politische Bildung sollte helfen, diese Unterschiede zu verstehen – und trotzdem klar Position zu beziehen.
Der inflationäre Gebrauch des Begriffs „Faschismus“ ist kein Kavaliersdelikt. Er verharmlost das, was Faschismus historisch war – und was er auch heute wieder werden kann. Wer alles als Faschismus bezeichnet, erkennt ihn am Ende nirgendwo mehr.
Unsere Slideshows zum Download
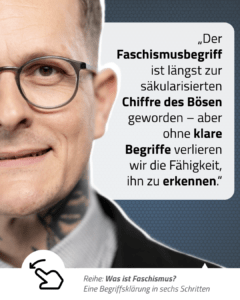
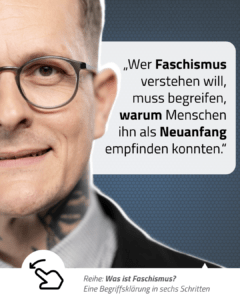
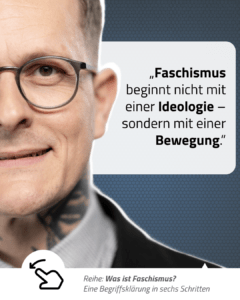
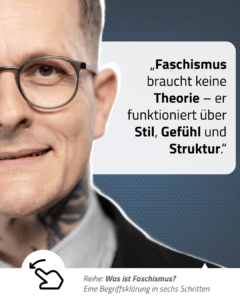

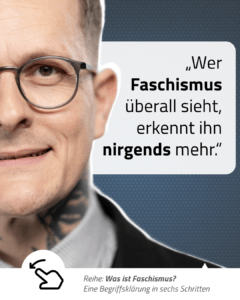
Fazit: Begriffsklärung ist Bildung. Und Bildung ist Prävention.
Was ist Faschismus?
Diese Frage lässt sich nicht mit einem Satz beantworten – und das ist auch gut so. Denn Faschismus ist kein starres Gebilde, sondern ein komplexes Geflecht aus Ideen, Praktiken, Symbolen und Stimmungen. Er kann sich unterschiedlich zeigen: als politische Bewegung, als kulturelle Ästhetik, als sprachliches Muster, als emotionale Mobilisierungsform.
Gerade deshalb war es Ziel dieser Blogreihe, nicht die Definition zu liefern – sondern verschiedene Perspektiven nebeneinander sichtbar zu machen. Jede von ihnen – Griffin, Paxton, Eco, Mosse, Sternhell, Snyder – beleuchtet einen anderen Aspekt. Zusammen ergeben sie ein facettenreiches Bild, das hilft, das Phänomen differenziert zu begreifen, statt es vorschnell zu etikettieren.
Für die politische Bildung bedeutet das:
- Wir dürfen Begriffe wie „Faschismus“ nicht moralisieren, sondern müssen sie erklärbar machen.
- Wir müssen junge Menschen, Multiplikator:innen und Fachkräfte in ihrer Urteilskraft stärken, nicht bloß in ihrer Empörung.
- Und wir brauchen Räume, in denen Widerspruch, Ambiguität und Differenz nicht als Schwäche gelten – sondern als Grundlage demokratischen Denkens.
Wenn wir über Faschismus sprechen, sprechen wir auch über uns: über unsere Sprache, unsere Ängste, unsere Sehnsucht nach Ordnung, unsere Umgangsweisen mit Komplexität. Wer politische Bildung ernst nimmt, muss genau hier ansetzen – nicht bei den Parolen, sondern bei den Erzählungen dahinter.
Diese Reihe ist ein Beitrag dazu. Kein abschließender. Aber ein begrifflich fundierter, lebensnaher und praxisorientierter.
Literatur & Empfehlungen
Roger Griffin
Griffin, Roger (1991): The Nature of Fascism. London: Routledge.
➡️ Der Klassiker zur Theorie des palingenetischen Ultranationalismus. Für alle, die Faschismus als Zukunftsversprechen verstehen wollen.
Robert O. Paxton
Paxton, Robert O. (2004): The Anatomy of Fascism. New York: Alfred A. Knopf.
➡️ Faschismus als politischer Prozess – kein Theoriebuch, sondern ein historisch fundiertes Frühwarnsystem.
Umberto Eco
Eco, Umberto (1995): Ur-Fascism. In: The New York Review of Books, June 22, 1995.
➡️ Ein pointierter Essay mit 14 strukturellen Merkmalen des „ewigen Faschismus“. Leicht zugänglich – schwer zu ignorieren.
📄 Online abrufbar (Englisch)
George L. Mosse
Mosse, George L. (1999): The Fascist Revolution: Toward a General Theory of Fascism. New York: Howard Fertig.
➡️ Faschismus als Massenästhetik, als emotionale und körperbezogene Identitätspolitik. Besonders wertvoll für kulturbezogene Bildungsarbeit.
Zeev Sternhell
Sternhell, Zeev (1994): The Birth of Fascist Ideology: From Cultural Rebellion to Political Revolution. Princeton: Princeton University Press.
➡️ Faschismus nicht als Reaktion, sondern als eigenständige politische Idee. Lesenswert, auch wenn anspruchsvoll.
Timothy Snyder
Snyder, Timothy (2017): On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century. New York: Tim Duggan Books.
➡️ Ein kompaktes, zugängliches Buch mit 20 demokratischen Prinzipien – geschrieben mit Blick auf Gegenwart und autoritäre Gefahren. Ideal für Einstiege.