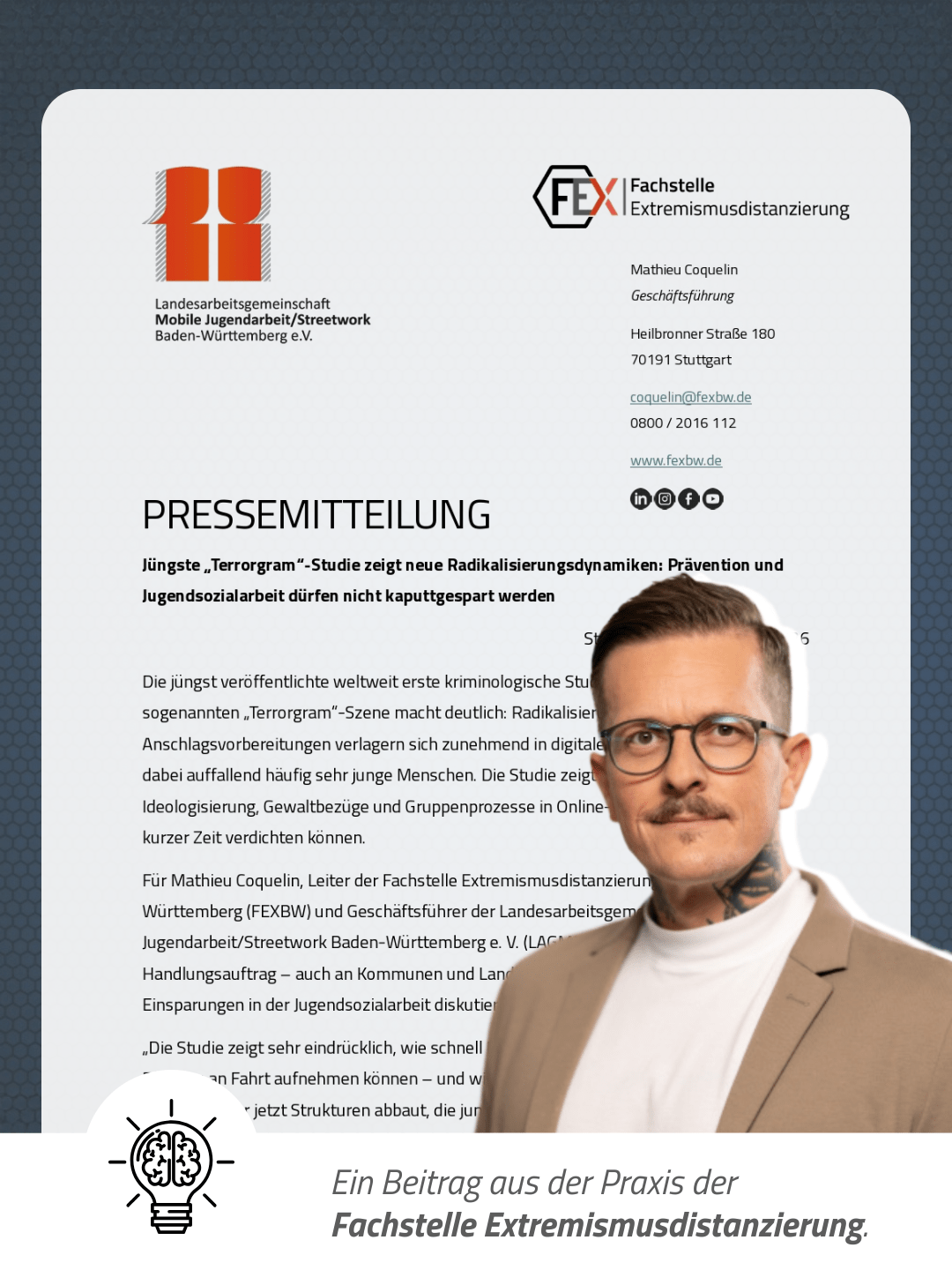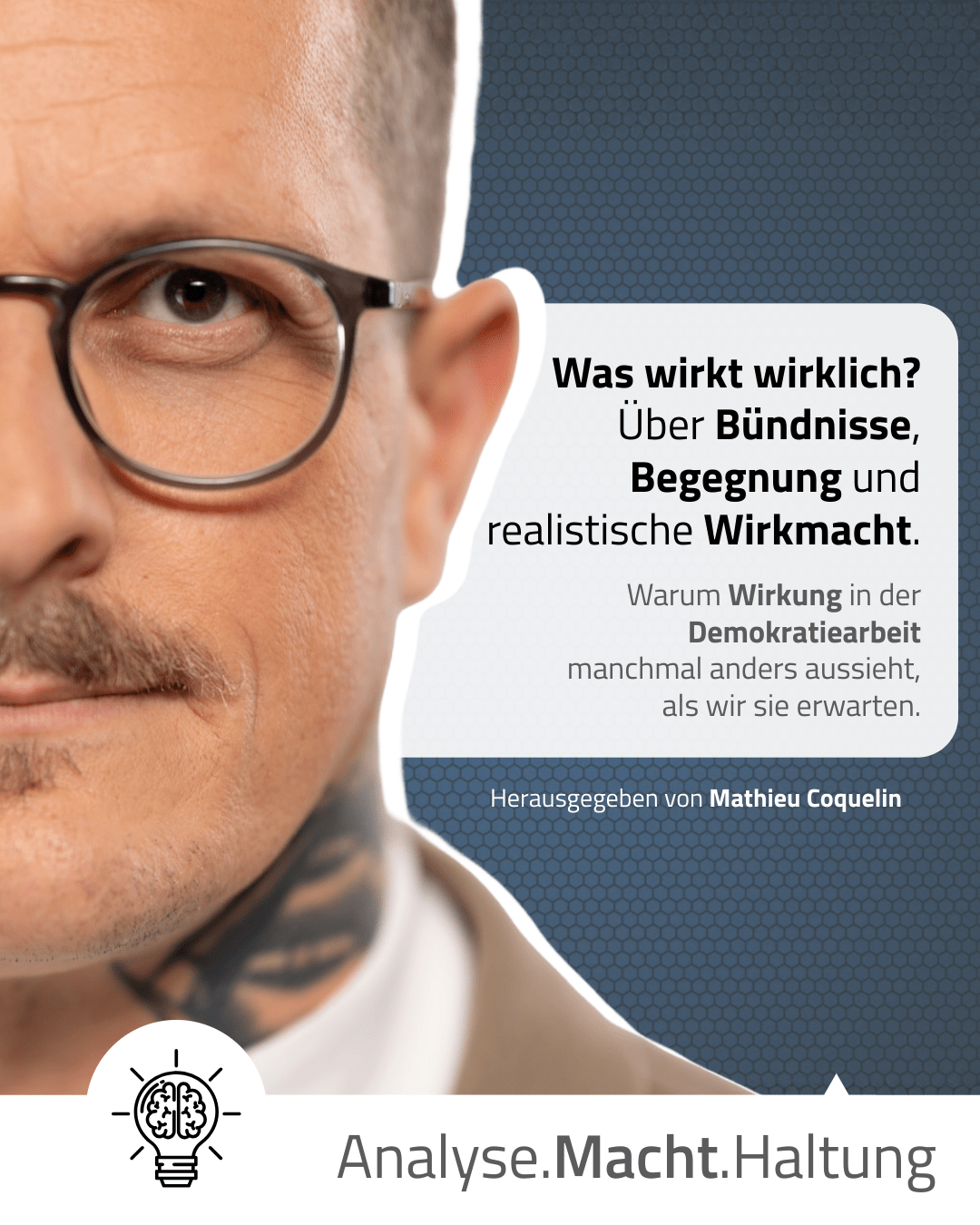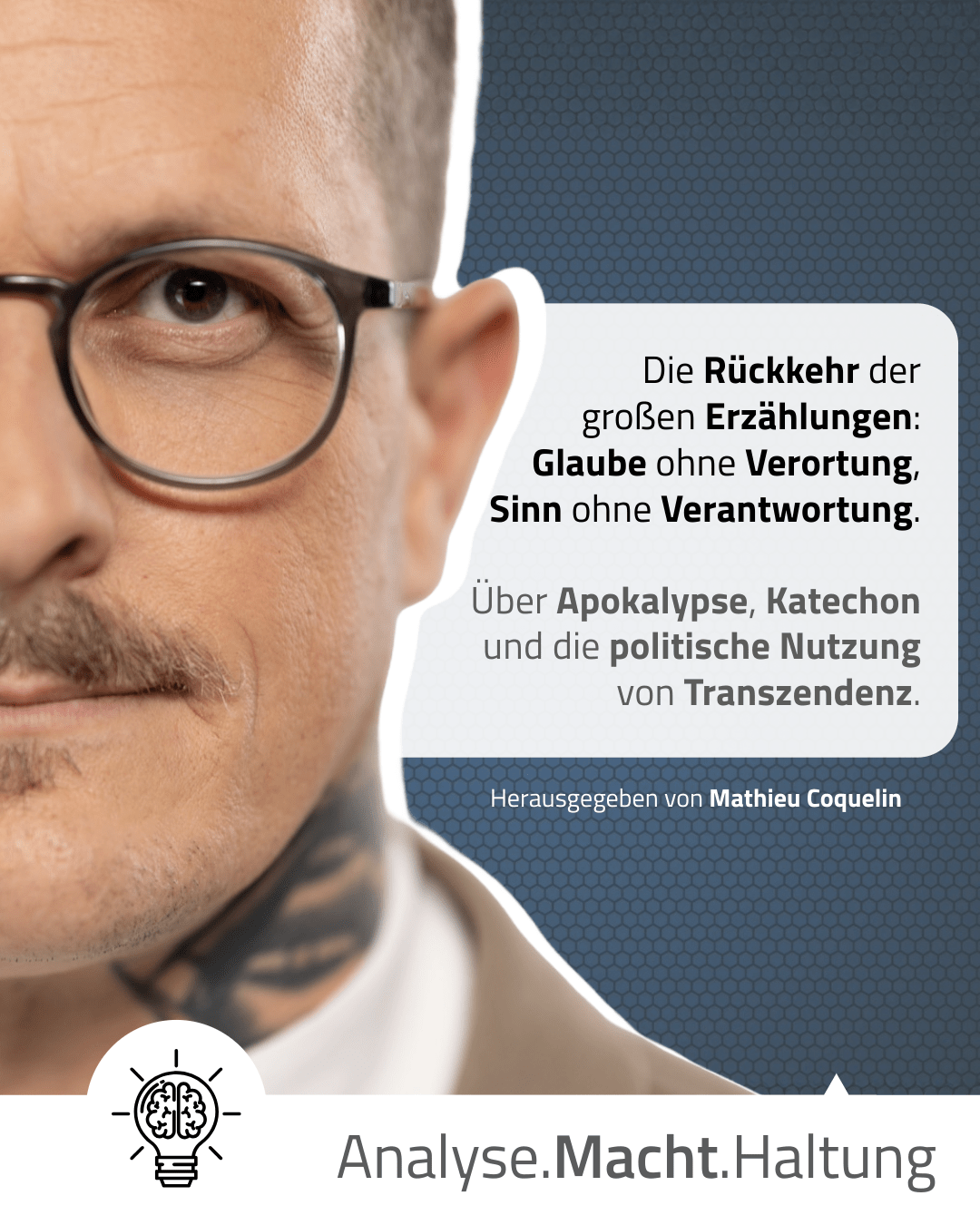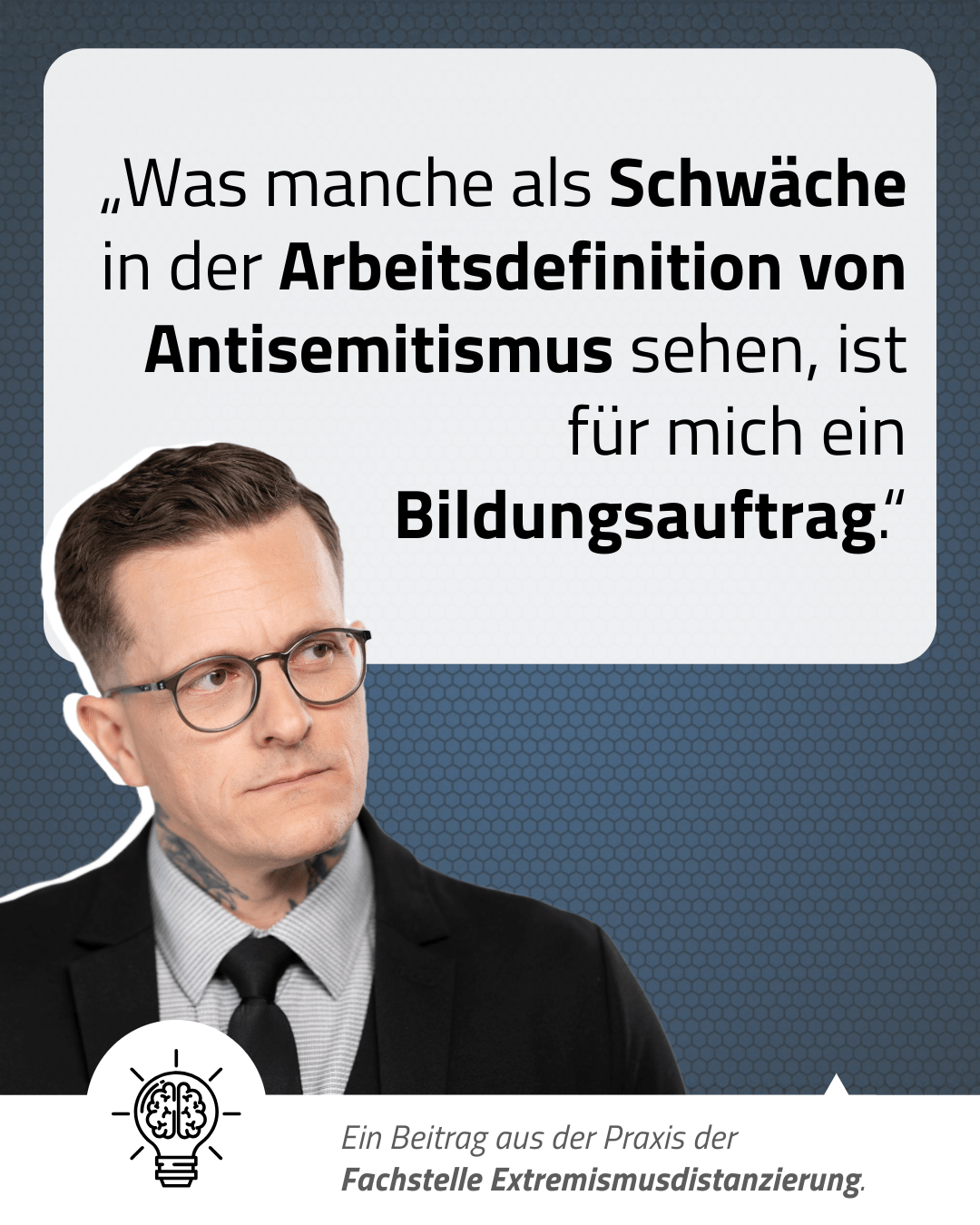
Warum wir keine neue Antisemitismusdefinition brauchen – sondern ein besseres Verständnis für „bestimmte Wahrnehmungen“
Antisemitismus definieren: Warum die Diskussion gerade jetzt relevant ist
In den letzten Tagen ist eine alte Debatte neu entflammt: Die Partei Die Linke hat auf ihrem Parteitag beschlossen, künftig nicht mehr die international etablierte IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus als Grundlage ihrer politischen Arbeit zu verwenden, sondern die sogenannte Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA). Der Beschluss war knapp, die Reaktionen deutlich – und die Diskussion darüber ist seither in vielen Fachkreisen und sozialen Medien spürbar präsenter geworden.
Mich hat dieser Beschluss nicht primär empört – sondern wach gemacht. Denn er rührt an eine Frage, die mich seit Jahren begleitet, sowohl in meiner Arbeit als Leiter einer Fachstelle für Extremismusdistanzierung als auch in meiner Lehrtätigkeit. Seit fünf Jahren ist Antisemitismus ein fest verankerter Baustein in unserem Vorlesungsformat zu Demokratieförderung, Extremismusprävention und politischer Bildung. In den ersten Jahren hatten wir dazu einen externen Gast: Prof. Dr. Armin Langer. Doch seit zwei Jahren übernehme ich diesen Teil selbst, weil Armin international stark eingebunden ist.
In jedem Durchlauf, ganz gleich mit welcher Kohorte, passiert etwas Ähnliches: Sobald die Studierenden verschiedene Definitionen von Antisemitismus vergleichen, kommen sie bei der IHRA-Definition regelmäßig an denselben Punkt. Es fällt der Satz:
„Was genau meint denn diese ‚bestimmte Wahrnehmung‘ gegenüber Jüdinnen und Juden?“
Genau hier beginnt mein Bildungsauftrag. Ich sehe es als meine Aufgabe, nicht bloß Definitionen zu referieren, sondern Studierende – und darüber hinaus gesellschaftliche Akteur:innen – dazu zu befähigen, mit dieser Definition arbeiten zu können. Wer verstehen will, was Antisemitismus ausmacht, muss lernen, bestimmte Wahrnehmungsstrukturen zu identifizieren – nicht bloß Begriffskarten auszutauschen.
Deshalb möchte ich in diesem Artikel keine neue Definition vorschlagen. Ich möchte vielmehr der Frage nachgehen:
Warum fällt es uns so schwer, mit der vorhandenen zu arbeiten – und was bräuchte es, um das zu ändern?
Der blinde Fleck der IHRA-Definition – Was heißt „bestimmte Wahrnehmungen“?
Die IHRA-Arbeitsdefinition beginnt mit einem Satz, der oft zitiert, aber selten zu Ende gedacht wird:
„Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber ihnen ausdrücken kann.“
Diese Formulierung klingt offen – fast strategisch abstrakt. Doch wer sich mit der Entstehungsgeschichte beschäftigt, merkt schnell: Die Offenheit war wahrscheinlich nicht das Ergebnis bewusster didaktischer Zurückhaltung, sondern eher Ausdruck eines gemeinsamen impliziten Verständnisses. Die Verfasser:innen hatten ein präzises Bild im Kopf, was mit dieser bestimmten Wahrnehmung gemeint war – sie hielten es nur offenbar nicht für nötig, es systematisch aufzuschlüsseln.
Doch genau darin liegt das Problem. Denn sobald diese Definition in breitere Bildungs- und Diskurskontexte eingebracht wird, fehlt vielen Rezipient:innen das nötige Vorwissen. Sie verstehen den Satz, aber sie verstehen nicht, was mit ihm gemeint ist.
An diesem Punkt hilft ein Blick auf das juristische Denken: Auch dort gibt es abstrakte Normen, wie etwa „sittenwidriges Verhalten“ oder „Gefährdung der öffentlichen Ordnung“. Diese Begriffe sind bewusst weit gefasst, weil sie nicht alles vorwegnehmen, sondern kontextabhängig durch Gerichte konkretisiert werden sollen – durch Auslegung, Fallpraxis, Kommentarliteratur. Die IHRA-Definition hingegen vertraut auf kollektives Wissen, ohne ein solches Korpus an Auslegungsbeispielen gleich mitzuliefern. Dadurch entsteht eine Leerstelle in der Vermittlung – nicht in der Intention, sondern in der Anwendung.
Noch komplexer wird es, wenn wir verstehen, wie Antisemitismus in unserer Gesellschaft wirkt. Die meisten antisemitischen Wahrnehmungen, die heute kursieren, sind nicht Teil bewusster Weltbilder, sondern wirken unterbewusst – als kulturelle Prägung, als tradierte Bildwelt, als gefühlte Plausibilität. Was wir über „die Juden“ zu wissen glauben – ohne es je gelernt zu haben – ist oft genau das, was sich unterhalb unserer bewussten Urteilsfähigkeit sedimentiert hat. Und genau das macht es so schwer, diese „bestimmten Wahrnehmungen“ zu erkennen, zu benennen und zu unterbrechen.
Die Folge ist ein doppelter blinder Fleck:
- Die Definition benennt ein Phänomen, das implizit bekannt, aber nicht explizit beschrieben wird.
- Und wir begegnen in der Bildungsarbeit einem Gegenüber, das diese Wahrnehmung nicht bewusst teilt, aber kulturell mitträgt.
Die IHRA-Definition ist nicht zu schwach. Unsere Fähigkeit, sie verständlich zu machen, ist unzureichend. Und genau dort beginnt der eigentliche Auftrag – nicht bei einer neuen Definition, sondern bei der Arbeit am kollektiven Wahrnehmungswissen.
Warum neue Definitionen (wie die JDA) nicht unbedingt mehr Klarheit bringen
Die Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) wurde als Reaktion auf die IHRA-Definition formuliert – unter dem Eindruck, dass die IHRA nicht nur unklar, sondern auch politisch missbraucht werde. Vor allem die Sorge, legitime Israelkritik könne vorschnell als antisemitisch gebrandmarkt werden, war treibendes Motiv hinter ihrer Entstehung.
Doch die JDA löst das Problem nicht – sie verschiebt es lediglich.
Denn anstelle der „bestimmten Wahrnehmung“ bietet sie eine neue Formel: Viele Aussagen über Israel seien nicht per se antisemitisch. Diese Formulierung klingt nach Entlastung – und genau das ist ihr Problem. Wo die IHRA zu viel Interpretationsarbeit offenlässt, liefert die JDA einen scheinbaren Schutzraum – aber keine neuen Maßstäbe zur Bewertung. Statt also antisemitische Zuschreibungen sichtbar zu machen, wird der Fokus verlagert: Weg von der Wahrnehmungsstruktur, hin zur politischen Absicht.
Das aber ändert nichts an der strukturellen Herausforderung: Antisemitismus funktioniert nicht über direkte Absicht, sondern über eingeübte Denkfiguren. Auch eine scharf formulierte Israelkritik kann diese Denkfiguren bedienen – etwa durch Dämonisierung, Entmenschlichung oder die Gleichsetzung mit dem NS-Regime. Das muss nicht heißen, dass jede Kritik antisemitisch ist – aber es heißt eben auch nicht, dass jede Kritik automatisch außerhalb des Problems steht.
Deshalb ist die zentrale Frage nicht:
„Welche Definition ist die richtige?“ Sondern: „Wer ist in der Lage, die jeweilige Definition so zu vermitteln, dass sie antisemitische Wahrnehmungen erkennbar macht – und nicht verschleiert?“
Wer sich wirklich für differenzierte Kritik stark machen will – sei es an Israel oder an Antisemitismusvorwürfen –, der braucht keine neue Definition. Er oder sie braucht das Wissen, wie sich bestimmte Wahrnehmungen erkennen, beschreiben und einordnen lassen.
Eine praktische Alternative – Präzisierung durch vertiefte Beschreibung statt durch neue Definition
Wenn man es ernst meint mit der Forderung nach Klarheit, dann müsste die Konsequenz doch nicht lauten: „Wir brauchen eine neue Definition.“ Sondern:
„Wir müssen die bestehende besser erklären.“
Die IHRA-Definition ist kein abgeschlossenes Regelwerk, sondern eher ein Bezugspunkt – ein Marker in einem Diskursfeld, das von historischen Tiefenschichten, gegenwärtigen Sprachmustern und gesellschaftlichen Verschiebungen durchzogen ist. Ihre Formel von der „bestimmten Wahrnehmung“ ist nicht falsch. Sie ist – im Gegenteil – bemerkenswert präzise. Sie benennt genau das, was Antisemitismus ausmacht: eine beständige, sich wandelnde Form der Wahrnehmung des imaginierten Jüdischen – also eines kulturell konstruierten Bildes, das selten mit realem jüdischem Leben, dafür aber umso mehr mit tradierten Projektionen zu tun hat.
Doch damit diese Definition wirksam wird, braucht es eine präzisierende Auslegung. Kein Ersatztext. Kein Gegentext. Sondern – wie im juristischen Bereich – eine Art Kommentierung oder Fallpraxis.
Man hätte – so banal es klingt – einfach eine Fußnote hinzufügen können. Eine, in der bestimmte Wahrnehmungsmuster exemplarisch benannt werden:
- Die Projektion von Machtkonzentration und verborgenem Einfluss.
- Die Vorstellung überindividueller strategischer Steuerung („Weltverschwörung“).
- Das Motiv der besonderen Rachsucht oder Unversöhnlichkeit.
- Die Gleichsetzung israelischer Politik mit dem NS-Regime (Holocaustrelativierung).
- Die Umkehrung von Täter-Opfer-Rollen in der Erinnerungskultur.
Mit solchen Beispielen ließe sich ein Verständnis aufbauen, das differenzieren hilft:
- Wann wird Kritik an israelischer Politik zur Projektion?
- Wann wird ein berechtigter Vorwurf zum antisemitischen Resonanzraum?
- Und wann wird ein Antisemitismusvorwurf zum politischen Machtmittel, das seinerseits auf stereotype Strukturen zurückgreift?
Das alles ließe sich nicht mit einer neuen Definition, sondern nur durch Vertiefung, Vermittlung und didaktische Arbeit ermöglichen. Das Problem ist nicht die Definition. Das Problem ist: Wir haben nicht genug investiert, um sie verstehbar, kontextualisierbar und diskussionsfähig zu machen.
Ein Werkzeug statt neuer Worte – unser KI-Projekt beim Hackathon gegen Antisemitismus
Was wäre also eine sinnvolle Reaktion auf die Vermittlungslücke zwischen Antisemitismusdefinition und gesellschaftlicher Anschlussfähigkeit? Nicht der nächste Text. Nicht die nächste Erklärung. Sondern ein Werkzeug – eines, das dort ansetzt, wo das Problem liegt: bei der Fähigkeit, antisemitische Wahrnehmungsmuster zu erkennen, zu deuten und einzuordnen.
Genau daran arbeiten wir – und zwar im Rahmen des Hackathons gegen Antisemitismus, der nächste Woche unter der Schirmherrschaft von Innenminister Thomas Strobl und Antisemitismusbeauftragtem Dr. Michael Blume stattfindet. Wir freuen uns sehr, dort unsere Idee vorstellen zu dürfen: Ein niedrigschwelliges, KI-gestütztes Analysewerkzeug, das antisemitische Strukturen in Bildinhalten identifizieren hilft.
Unser Ansatz: Wir entwickeln ein niedrigschwelliges, KI-gestütztes Analysewerkzeug, das antisemitische Wahrnehmungsfiguren in Bildinhalten identifizierbar macht – nicht als automatische Entscheidung, sondern als pädagogisch nutzbares Reflexionsinstrument. Dazu arbeiten wir mit einem einfachen, aber wirkungsvollen Scoring-System, das drei Kategorien unterscheidet:
- Unbewusste Reproduktion antisemitischer Tropen,
- Ambivalente Graubereiche mit kontextsensibler Auslegungsnotwendigkeit,
- Manifest antisemitische Strukturen, ggf. mit rechtlicher Relevanz.
Die technische Umsetzung basiert auf gezieltem Prompt-Design: Statt binärer Bewertung ermöglicht die KI eine kommentierende, differenzierte Analyse – orientiert an diskursiven Leitlinien statt reiner Mustererkennung.
Das Projekt entsteht gemeinsam mit meinen großartigen Kolleg:innen Tamara Wagner und Steffen Zimmermann, mit denen ich diesen Prototyp auch über den Hackathon hinaus weiterentwickeln möchte.
Ich freue mich besonders, dass sich bereits im Vorfeld interessante Anknüpfungspunkte ergeben haben – etwa mit Hüseyin Çiçek, Matthias J. Becker, [Hier könnte Dein Name stehen :)] –, um das Projekt künftig interdisziplinär und praxisnah weiterzudenken.
Die Bewerbungsphase für Teilnehmende ist zwar abgeschlossen, aber wir freuen uns sehr auf die Diskussion im Panel, auf kritische Perspektiven und viele produktive Reibungen.
Denn eines ist klar:
Antisemitismus lässt sich nicht allein durch Definitionen bekämpfen. Aber vielleicht durch Werkzeuge, die helfen, ihn zu verstehen – und sichtbar zu machen.
Warum Verantwortung über Sprache kein schmaler Grat ist
Es ist ein weit verbreitetes Bild: Der Umgang mit Antisemitismus sei ein schmaler Grat – zwischen legitimer Kritik und überzogener Empfindlichkeit, zwischen politischem Argument und historischem Ballast. Doch je länger ich mich mit dem Thema befasse, desto weniger teile ich dieses Bild.
Denn Verantwortung für Sprache ist kein Drahtseilakt – sie beginnt bei der Person, die spricht.
Wer Kritik übt – sei es an staatlichem Handeln, an gesellschaftlichen Entwicklungen oder an konkreten Akteur:innen – trägt Verantwortung dafür, wie er oder sie das tut. Das schließt die Wahl der Bilder, der Begriffe, der Vergleiche mit ein. Und gerade in einem Feld wie der Nahostdebatte, das historisch und emotional so aufgeladen ist, zeigt sich, wie viel hier im Ungefähren bleibt – und wie häufig dabei antisemitische „bestimmte Wahrnehmungen“ (um mit der IHRA-Definition zu sprechen) mitschwingen, oft unbewusst, manchmal absichtsvoll.
Natürlich ist Kritik erlaubt – aber sie ist nicht grenzenlos.
Wer verstanden hat, wie antisemitische Wahrnehmungen historisch funktionieren, hat keinen Mangel an Sprache. Er oder sie hat vielmehr die Verpflichtung, eine Sprache zu wählen, die nicht abwertet, nicht dämonisiert, nicht entmenschlicht.
Und genau darum geht es bei unserem Scoring-Modell: Es soll nicht entscheiden, was gesagt werden darf – sondern helfen, sichtbar zu machen, welche Wahrnehmungsmuster in bestimmten Formulierungen fortleben, oft unterhalb der bewussten Absicht. Es geht darum, Sprachbewusstsein zu stärken – nicht darum, Diskussionen zu blockieren.
Dazu gehört auch ein Seitenblick auf eine andere Debatte: Immer wieder wird gefragt, warum Israel im globalen Diskurs so stark im Fokus steht – während andere Konflikte, andere Formen von Gewalt, andere Vertreibungen vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit erhalten. Diese Frage ist legitim – aber sie darf nicht zur Relativierung führen. Denn Sichtbarkeit ist kein Nullsummenspiel. Dass Antisemitismus auf besondere Weise historisch codiert ist, bedeutet nicht, dass andere Leiden weniger zählen – aber es bedeutet, dass bestimmte sprachliche Muster in der Kritik an Israel mehr Aufmerksamkeit verdienen, nicht weniger.
Antisemitismus beginnt nicht erst beim bewussten Hass. Er beginnt dort, wo Sprache das Unsichtbare normalisiert – und das Sagbare verschiebt.
Fazit – Klare Worte statt neuer Definitionen
Antisemitismus lässt sich nicht durch neue Definitionen eindämmen. Er lässt sich auch nicht durch politische Beschlüsse auflösen oder durch die bloße Behauptung von Differenzierung entschärfen.
Was wir brauchen, ist etwas anderes:
eine kollektive Anstrengung, Sprache ernst zu nehmen. eine Pädagogik, die Wahrnehmungsmuster aufdeckt, bevor sie zu Vorwürfen werden. eine digitale und gesellschaftliche Infrastruktur, die nicht nur reagiert, sondern befähigt.
Die IHRA-Definition hat Schwächen, ja – aber keine, die sich durch neue Begriffe beheben ließen. Ihre Schwäche liegt nicht in ihrer Offenheit, sondern in unserer Unfähigkeit, sie zu vermitteln. Wer diese Leerstelle wirklich füllen will, braucht kein alternatives Papier. Er braucht Werkzeuge, die helfen, das Unsichtbare sichtbar zu machen – in Bildern, in Sprache, in Symbolen. Genau daran arbeiten wir.
Ob unser Projekt beim Hackathon eine Zukunft hat, wird sich zeigen. Ob der Diskurs eine Zukunft hat, hängt von etwas anderem ab: Wer sich mit Antisemitismus beschäftigt, muss nicht lauter werden – sondern klarer. Und wer Verantwortung übernimmt, muss nicht alles wissen – aber bereit sein, zu lernen.
Haltung braucht Analyse. Und Analyse braucht Begriffe, die nicht bloß definieren, sondern zum Denken befähigen.