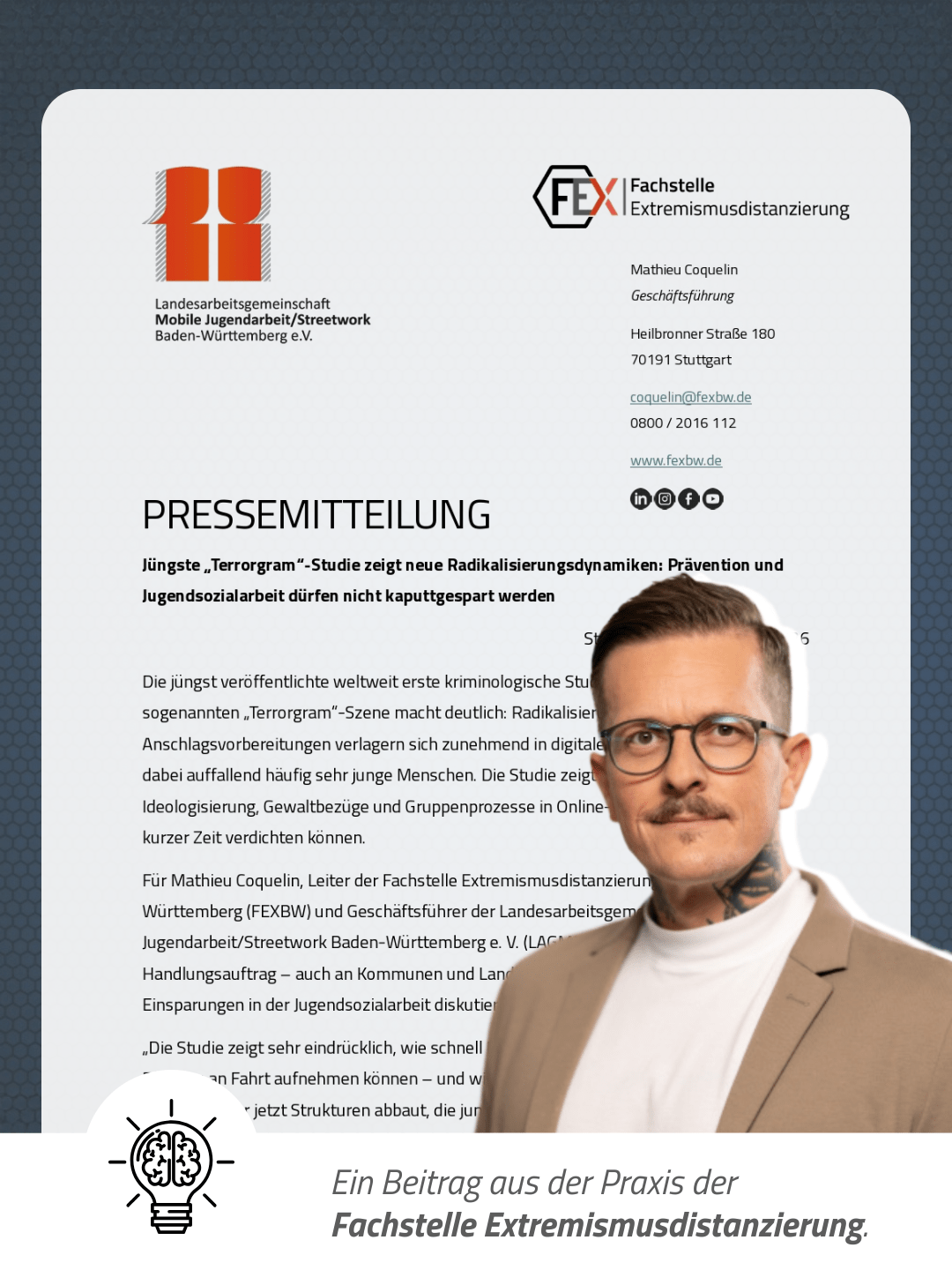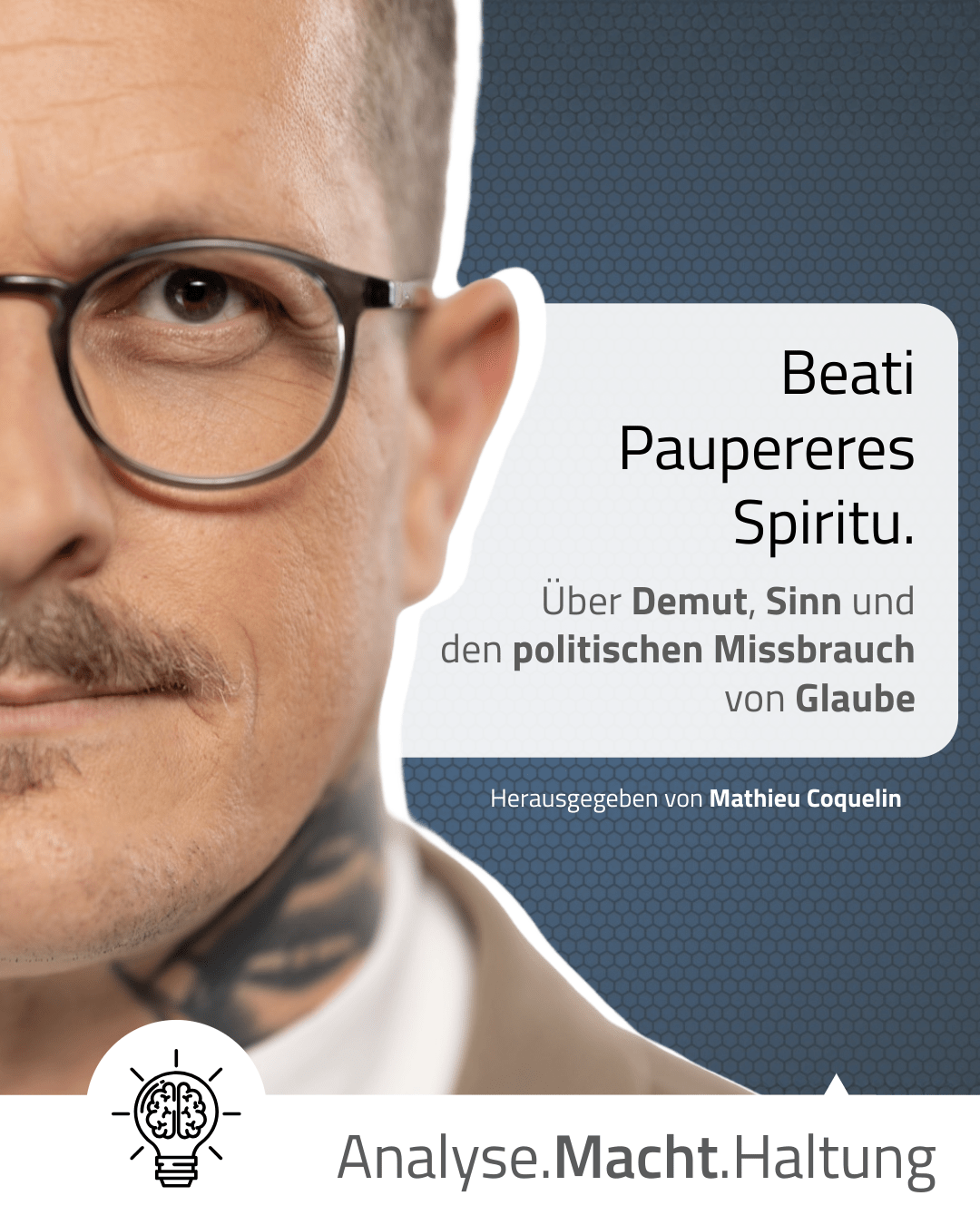
Beati pauperes spiritu – Warum Glaube, Sinnsuche und Rechtsruck zusammenhängen
Die Erfahrung, nichts zu verstehen
Es gibt diese Situationen, in denen man merkt, dass man sich auf vertrautem Terrain bewegt und es dennoch verliert. Empfänge, bei denen man niemanden kennt. Gespräche, in denen Begriffe fallen, die man nicht einordnen kann. Fachliche Austausche, bei denen man innerlich kurz innehält und feststellt: Ich verstehe gerade sehr wenig.
Solche Momente sind irritierend. Vor allem dann, wenn man sich im eigenen Feld eigentlich sicher fühlt. Wenn man über Jahre Expertise aufgebaut hat, Routinen kennt, Zusammenhänge erklären kann. Und dann steht man plötzlich in einem interdisziplinären Kontext und merkt, wie schnell diese Sicherheit brüchig wird. Nicht, weil die anderen klüger wären. Sondern weil sie aus völlig anderen Denkwelten sprechen.
In den letzten Jahren habe ich mich bewusst in solche Kontexte begeben. Der Aufbau eines interdisziplinären Zentrums hat diese Erfahrungen noch einmal verdichtet. Unterschiedliche Professionen, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Selbstverständlichkeiten. Menschen, die hochqualifiziert sind, oft promoviert, deren fachliche Tiefe beeindruckend ist und deren Gespräche man kaum versteht, wenn sie einmal richtig in ihre Themen eintauchen. Und vermutlich geht es ihnen umgekehrt ganz ähnlich.
Was mich daran fasziniert, ist weniger die anfängliche Irritation als das, was danach passiert. Der Moment, in dem man sich entscheiden muss: Ziehe ich mich zurück, weil mir der Boden unter den Füßen fehlt? Oder halte ich diese Erfahrung aus? Sortiere ich für mich, was ich nicht weiß und finde einen Zugang, der nicht auf Überlegenheit beruht, sondern auf Neugier?
Mit der Zeit entsteht genau hier etwas Produktives. Wenn man anfängt, Fragen zu stellen. Wenn Begriffe übersetzt werden. Wenn sich zeigt, dass hinter sehr unterschiedlichen Fachsprachen oft erstaunlich ähnliche Grundannahmen liegen. Und wie häufig sich etwa lebensweltorientierte Perspektiven in ganz unterschiedlichen Disziplinen wiederfinden, nur jeweils anders begründet, anders gerahmt, anders ausgesprochen.
Diese Erfahrung hat meinen Blick verändert. Sie hat mir gezeigt, dass Nicht-Verstehen kein Mangel sein muss. Sondern eine Haltung. Eine, die anerkennt, dass die Welt komplexer ist als das eigene Wissensfeld. Und dass Erkenntnis oft dort beginnt, wo man aufhört, alles erklären zu wollen.
Vielleicht ist das eine der wichtigsten Lektionen interdisziplinärer Arbeit: Demut. Nicht als Selbstverkleinerung, sondern als Anerkennung von Begrenztheit. Als Bereitschaft, sich irritieren zu lassen. Und als Voraussetzung dafür, überhaupt in einen echten Austausch zu kommen.
Von hier aus lässt sich weiterdenken. Nicht nur über Zusammenarbeit, Wissenschaft oder Professionen. Sondern auch über Fragen, die tiefer reichen. Über Sinn, über Orientierung und über Begriffe, die älter sind als unsere Disziplinen, uns aber bis heute begleiten.
Interdisziplinarität als Praxis der Demut
Was in interdisziplinären Kontexten sichtbar wird, ist weniger ein methodisches Problem als eine Haltungsfrage. Die Irritation entsteht nicht, weil Wissen fehlt, sondern weil unterschiedliche Wissensordnungen aufeinandertreffen und keine davon den Anspruch erheben kann, für sich allein ausreichend zu sein.
Interdisziplinarität zwingt dazu, diese Begrenztheit anzuerkennen. Sie entzieht dem eigenen Fach die Möglichkeit, sich absolut zu setzen. Genau darin liegt ihre produktive Zumutung. Nicht alles lässt sich übersetzen. Nicht jede Perspektive integrieren. Aber jede fordert dazu heraus, die eigene Position zu relativieren.
Demut meint hier keine Bescheidenheit im moralischen Sinn. Sie beschreibt eine Haltung, die Mehrdeutigkeit aushält, ohne sie vorschnell aufzulösen. Wer lernt, widersprüchliche Perspektiven nebeneinander stehen zu lassen, erhöht damit etwas, das weit über den fachlichen Kontext hinausweist: Ambiguitätstoleranz. Die Fähigkeit, Unsicherheit, Unschärfe und offene Fragen nicht als Bedrohung zu erleben, sondern als Teil einer komplexen Wirklichkeit.
Gerade in Zeiten, in denen einfache Antworten und klare Schuldzuweisungen an Attraktivität gewinnen, ist das kein Nebenaspekt. Es ist eine Ressource. Eine, die schützt vor ideologischer Verengung und vor dem Reflex, Komplexität durch Härte zu ersetzen.
An diesem Punkt beginnt sich eine Verbindung zu öffnen. Zwischen beruflicher Praxis und einer Haltung, die nicht neu ist. Zwischen moderner Wissensarbeit und einem Satz, der oft missverstanden wird und der gerade deshalb eine überraschende Aktualität besitzt.
Beati pauperes spiritu – eine Erfahrung, kein Dogma
„Beati pauperes spiritu.“
Selig sind die geistig Armen.
Es ist einer dieser Sätze, die man zu kennen glaubt und die man doch lange umgeht. Vielleicht, weil sie sperrig klingen. Vielleicht, weil sie missverständlich sind. Oder weil sie so leicht in eine Ecke gestellt werden können, in die man selbst nicht möchte: anti-intellektuell, weltabgewandt, naiv.
Und doch ist mir dieser Satz in den letzten Jahren immer wieder begegnet. Nicht als theologisches Postulat. Sondern als Erfahrung. Als etwas, das ich aus beruflicher Praxis kenne, aus interdisziplinären Räumen, aus Momenten, in denen klar wird, dass Verstehen nicht gleich Verfügen heißt.
Je länger ich mich in solchen Kontexten bewege, desto häufiger stelle ich fest, wie oft sich Erfahrungen aus meinem beruflichen Alltag mit Haltungen verbinden lassen, die ich an ganz anderer Stelle gelernt habe. Nicht als fertige Antworten, sondern als Orientierung. Als Umgang mit Begrenztheit. Als Bereitschaft, nicht sofort zu wissen, wie etwas einzuordnen ist.
Manchmal entsteht daraus ein irritierender Gedanke: Wenn das immer schon gemeint war, wie viel Weisheit steckt dann eigentlich in solchen Sätzen?
Nicht im Sinne eines rückwärtsgewandten Wahrheitsanspruchs. Sondern als gespeicherte Erfahrung. Als Verdichtung dessen, wie Menschen über Jahrhunderte mit Unsicherheit, Angst, Überforderung und Verantwortung umgegangen sind. „Geistig arm“ wäre dann keine Abwertung, sondern die bewusste Anerkennung, dass Wissen begrenzt bleibt. Dass Kontrolle eine Illusion ist. Und dass genau daraus eine bestimmte Haltung erwächst.
Eine Haltung, die dem Nicht-Wissen Raum gibt. Die Offenheit nicht als Schwäche begreift. Und die Sinn nicht aus Überlegenheit zieht, sondern aus Beziehung zu anderen, zur Welt, zu sich selbst.
An dieser Stelle kippt der Blick. Weg von der Frage, was Glaube behauptet. Hin zu der Frage, wofür er genutzt werden kann. Denn so sehr sich diese Haltung als Ressource beschreiben lässt, so deutlich wird zugleich: Glaube ist nicht neutral. Er wird eingesetzt. Gedeutet. Funktionalisiert.
Wenn Glaube gebraucht – und missbraucht – wird
Vielleicht ist es kein Zufall, dass Glaube gerade jetzt wieder gebraucht wird. In einer Zeit, in der sich Krisen überlagern und verdichten: Klimawandel, Kriege, die reale Möglichkeit globaler Eskalationen. Zukunftsszenarien, die nüchtern beschrieben werden und dennoch eine existenzielle Unruhe erzeugen. Vieles daran wirkt, ohne religiös zu sein, nahezu apokalyptisch.
In solchen Zeiten suchen Menschen nach Orientierung. Nach Deutung. Nach etwas, das größer ist als das eigene Handlungsvermögen. Glaube bietet dafür seit jeher eine Sprache. Er benennt Endlichkeit. Er hält Widersprüche aus. Er stellt Sinnfragen, wo Kontrollversprechen an ihre Grenzen kommen. In diesem Sinne wird Glaube gebraucht.
Und genau hier beginnt die Ambivalenz.
Denn dort, wo Glaube gebraucht wird, wird er auch missbraucht. Nicht zwingend aus Bosheit, oft aus Leerstelle. Aus dem Schweigen derer, die ihn reflektiert leben könnten. Aus der Zurückhaltung jener, die religiöse Sprache kennen, sich aber aus guten Gründen aus öffentlichen Debatten zurückgezogen haben, weil sie nicht missionieren wollen oder Instrumentalisierung fürchten.
So entsteht ein Vakuum. Und dieses Vakuum bleibt selten leer.
Glaube wird dann nicht mehr als Suchbewegung verstanden, sondern als Setzung. Nicht als Einladung zur Demut, sondern als Angebot zur Eindeutigkeit. Er wird reduziert auf Bräuche, Rituale, kulturelle Marker und verliert dabei den Kontakt zu dem, worum es ihm eigentlich geht: zur Seele, zur Frage nach Würde, Verantwortung und Beziehung. Wo nicht mehr gerungen wird, wird behauptet.
Das Wortspiel ist dabei mehr als sprachlich: gebrauchen, missbrauchen, verbrauchen. Glaube wird funktional, wo er eigentlich existenziell sein müsste. Er dient der Beruhigung oder der Abgrenzung, der Stabilisierung von Identität oder der Legitimation von Härte. Und er wird umso anschlussfähiger, je weniger er sich selbst noch infrage stellen muss.
Gerade darin liegt die Gefahr. Nicht im Glauben selbst, sondern in seiner Verkürzung. In der Verwechslung von Gewissheit mit Wahrheit. In der Flucht vor Mehrdeutigkeit zugunsten einfacher Antworten.
Endzeit als Mobilisierung: Warum apokalyptische Erzählungen so stark wirken
Dass Endzeitnarrative eine besondere Mobilisierungskraft besitzen, ist kein exklusiv christliches Phänomen. Radikalisierungsforschung zeigt seit Jahren, wie wirksam apokalyptische Erzählungen dort werden, wo Leidensdruck, Kontrollverlust und Sinnsuche zusammentreffen.
Ein besonders deutliches Beispiel dafür war der sogenannte Islamische Staat. In seiner Propaganda spielte die Ebene von Dabiq eine zentrale Rolle. Sie wurde als Ort der finalen Auseinandersetzung inszeniert, gestützt auf endzeitliche Prophezeiungen. Diese Erzählung verdichtete individuelles Leid zu kosmischer Bedeutung, verlieh Ohnmacht historischen Sinn und beschleunigte Radikalisierungsprozesse, indem sie die Gegenwart als letzte Entscheidungssituation rahmte.
Wer sich in einer solchen Logik wiederfindet, erlebt Zweifel nicht mehr als Reflexion, sondern als Verrat. Ambivalenz wird zur Schwäche, Zeit zur Dringlichkeit. Genau darin liegt die Mobilisierungskraft von Endzeitnarrativen: Sie verwandeln Unsicherheit in Handlungspflicht.
Strukturell ähneln sich diese Muster über religiöse Grenzen hinweg. Auch im evangelikalen Spektrum spielen endzeitliche Deutungen eine mobilisierende Rolle, etwa dort, wo geopolitische Entscheidungen religiös aufgeladen und als Teil eines finalen Plans interpretiert werden. Entscheidend ist dabei nicht der jeweilige Glaube, sondern die Funktion der Erzählung: Angst bündeln, Identität stiften, moralische Eindeutigkeit erzeugen.
Wo Endlichkeit nicht ausgehalten wird, wird sie dramatisiert. Wo Sinnfragen nicht offen gestellt werden, werden sie beantwortet, bevor sie überhaupt gestellt werden dürfen.
Verantwortung in Zeiten von Sinn, Krise und Zuspitzung
So wie der nationale Rechtsruck nicht verstanden werden kann, ohne den globalen mitzudenken, lässt sich auch keiner von beiden hinreichend erklären, ohne die religiöse Dimension in den Blick zu nehmen. Nicht als Randaspekt. Sondern als wirksames Sinn- und Identitätsangebot in Zeiten tiefgreifender Verunsicherung.
Religion begegnet dem Rechtsruck nicht zufällig. Sie wird Teil seiner Sprache, seiner Bilder, seiner Versprechen. Wo Unsicherheit wächst, wird Sinn politisch. Wo Ambiguität schwer auszuhalten ist, werden Gewissheiten attraktiv. Und wo Deutungsvakuums entstehen, werden sie gefüllt, nicht immer von denen, die Demut, Verantwortung und Würde ins Zentrum stellen würden.
Gerade in einer Zeit, in der wissenschaftliche Erkenntnisse auf reale, existenzielle Krisen verweisen, entsteht ein Spannungsfeld, das viele Menschen überfordert. Wenn Prognosen keine einfachen Auswege mehr lassen, wächst der Wunsch nach Entlastung. Religiöse Deutungen können diese Entlastung bieten, indem sie relativieren oder überhöhen. Beides wirkt. Beides entzieht sich der Zumutung, Verantwortung auszuhalten.
Hinzu kommt ein zweites Moment: Zugehörigkeit. In einer fragmentierten Welt versprechen identitäre religiöse Angebote Gemeinschaft ohne Ambivalenz. Man gehört dazu, nicht weil man ringt, zweifelt oder Verantwortung übernimmt, sondern weil man ist, was man ist. Elite durch Identität, nicht durch Haltung. Das ist anschlussfähig, aber es hat mit dem Kern religiöser Ethik wenig zu tun.
Gerade deshalb reicht es nicht, Religion aus öffentlichen Debatten herauszuhalten oder sie auf kulturelle Symbole zu reduzieren. Kreuze an Wänden ersetzen keine Auseinandersetzung mit dem, was sie bedeuten sollen. Wo Glauben nur markiert wird, aber nicht getragen, wird er zur Projektionsfläche und damit offen für Vereinnahmung.
Was es stattdessen braucht, sind glaubwürdige Gegenangebote. Stimmen, die Zugehörigkeit nicht über Abgrenzung herstellen, sondern über Verantwortung. Die Identität nicht behaupten, sondern leben. Die den Kern religiöser Traditionen ernst nehmen: Demut, Würde, Universalität. Und die daraus Offenheit ableiten, nicht Ausschluss.
Dass sich Religion und Radikalisierung im globalen Rechtsruck gerade begegnen, ist kein Zufall. Wie darauf geantwortet wird, sollten wir nicht denen überlassen, die Glaube zur Abgrenzung brauchen.