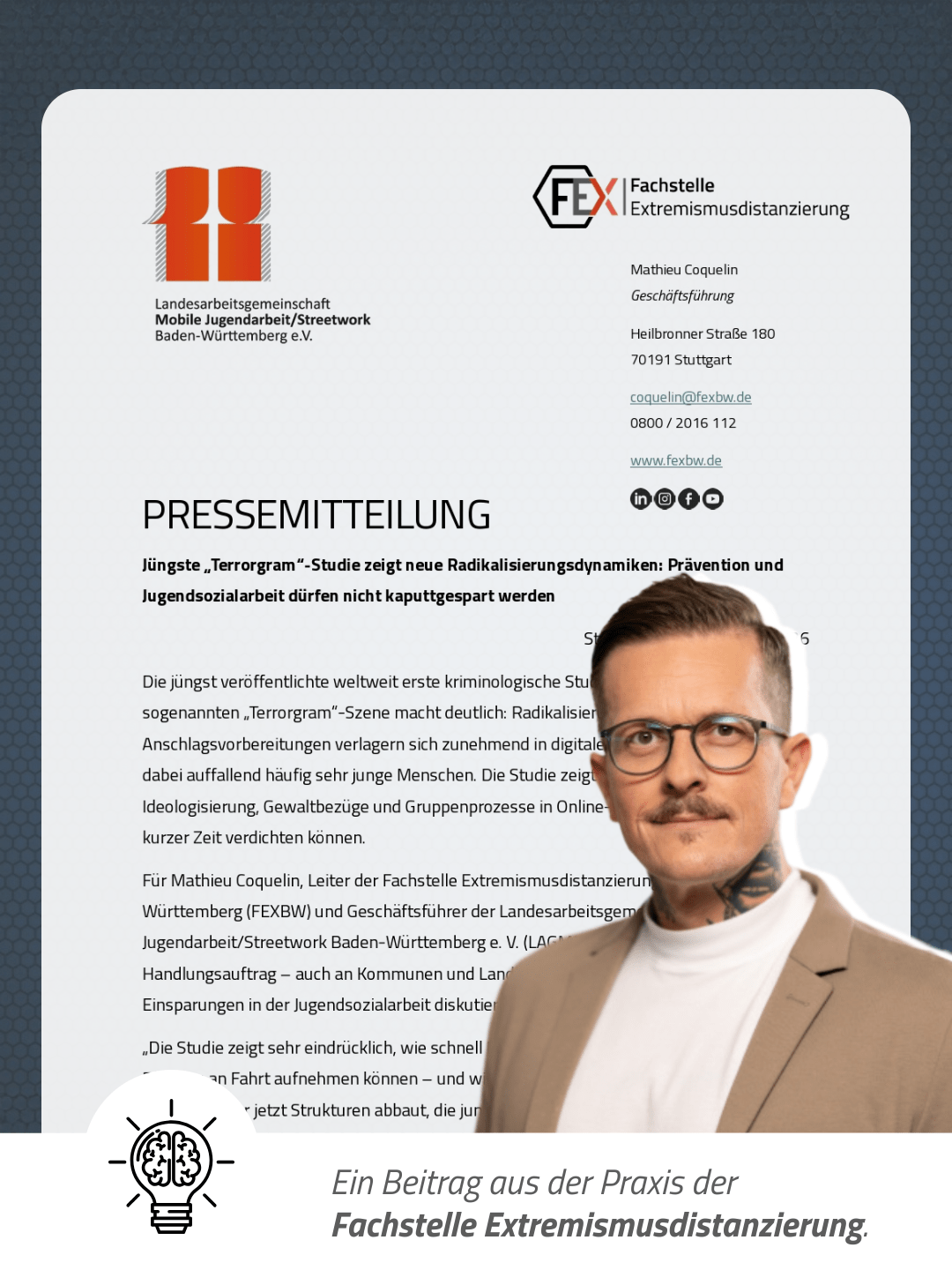Die Rückkehr der großen Erzählungen: Glaube, Sinn und Politik
Ausgangspunkt: Eine irritierende Beobachtung
Diese Gedanken begleiten mich länger, als ich selbst lange wahrhaben wollte.
Erstmals irritiert haben sie mich 2016 – in der Auseinandersetzung mit islamistischer Radikalisierung. Schon damals zeigte sich, wie eng politische Gewalt, Sinnsuche und Spiritualität miteinander verschränkt sein können. Und wie schwer wir uns als Gesellschaft damit getan haben, diesen Rekurs auf Transzendenz ernst zu nehmen – jenseits von Sicherheitslogiken oder reiner Ideologiekritik.
Damals ging es mir weniger um theologische Kategorien als um eine professionelle Irritation. Die entscheidende Frage war nicht, ob diese Deutungen falsch sind – das sind sie häufig –, sondern warum sie für so viele Menschen anschlussfähig wurden. Was sie emotional, existenziell und symbolisch leisten konnten, das nüchterne Fakten allein offenbar nicht zu leisten vermochten.
Während der Pandemie wurde diese Irritation erneut virulent. Verschwörungserzählungen erklärten die Welt nicht nur – sie ordneten sie. Sie boten Sinn, Schuldige und Erlösungsversprechen. Und damit erneut etwas, das wissenschaftliche Evidenz in ihrer notwendigen Vorläufigkeit oft nicht leisten konnte.
Der aktuelle Anlass dieses Artikels ist die Rückkehr religiöser Denkfiguren in politischen und technologischen Diskursen – besonders dort, wo sie offen strategisch genutzt werden. Wenn apokalyptische Motive, Opfer-Narrative oder die katechonische Vorstellung eines notwendigen Aufhalters des Zusammenbruchs bemüht werden, geht es nicht um Religion im engeren Sinne. Es geht um Sinn, Ordnung und um die Legitimation von Macht.
Dieser Text ist der Versuch, diese Entwicklung einzuordnen. Er ist ausdrücklich nicht aus einer theologischen Perspektive geschrieben. Vielmehr wirft er aus einer radikalisierungstheoretischen und politisch-bildnerischen Sicht einen Blick auf die Wiederkehr theologischer Denkfiguren – und fragt danach, welche Funktion sie in politischen und ideologischen Deutungsmustern übernehmen. Ohne Alarmismus, aber auch ohne die Annahme, dass diese Bedeutungsverschiebung folgenlos bleibt.
Am Ende des Textes skizziere ich drei Konsequenzen, die sich aus dieser Beobachtung ergeben: für politische Bildung und Prävention, für den öffentlichen Umgang mit religiösen Begriffen und für die Art, wie wir ideologischen Verkürzungen widersprechen können. Nicht als Handlungsanweisung, sondern als Orientierungsangebote.
Die gängige Erzählung: Die Welt wird säkularer
Der naheliegende Referenzrahmen für diese Beobachtungen ist die weit verbreitete Annahme, wir lebten in einer zunehmend säkularen Gesellschaft. Religion, so die gängige Erzählung, verliere an Bedeutung: Kirchen leeren sich, religiöse Praxis nehme ab, Glaubensfragen würden privatisiert oder ganz verdrängt. Moderne Gesellschaften erscheinen in dieser Perspektive vor allem als rationalisiert, wissenschaftlich orientiert und funktional organisiert.
Diese Diagnose ist nicht aus der Luft gegriffen. Sie lässt sich empirisch stützen und prägt politische wie kulturelle Selbstbeschreibungen seit Jahrzehnten. Religion gilt dabei oft als etwas Vergangenes – als Überrest früherer Sinnordnungen, die durch Fortschritt, Bildung und Aufklärung abgelöst worden seien. In diesem Deutungsrahmen wirken religiöse Begriffe im politischen oder öffentlichen Raum eher wie Anachronismen oder rhetorische Provokationen.
Gerade deshalb irritiert es, wenn sich religiöse Semantiken nicht einfach zurückziehen, sondern an anderer Stelle wieder auftauchen. Die Annahme einer linearen Entwicklung von religiös zu säkular greift offenbar zu kurz. Sie erklärt, warum Institutionen an Bindungskraft verlieren – aber nicht, warum Fragen nach Sinn, Ordnung, Schuld oder Erlösung weiterhin virulent bleiben. Die Vorstellung einer vollständig „entzauberten“ Welt unterschätzt möglicherweise, wie dauerhaft diese Fragen in modernen Gesellschaften verankert sind.
An diesem Punkt wird deutlich: Die Diagnose der Säkularisierung beschreibt einen realen Prozess, aber sie erklärt noch nicht, was mit den Sinnbedürfnissen geschieht, die Religionen über lange Zeit bearbeitet haben. Um das zu verstehen, lohnt es sich, genauer hinzuschauen – zunächst auf das, was empirisch tatsächlich verschwindet, und dann auf das, was bleibt.
Institutionelle Säkularisierung
Schaut man auf die institutionelle Ebene, ist die Diagnose eindeutig: Die großen Kirchen verlieren seit Jahren kontinuierlich an Bindungskraft. Die Zahl der Kirchenaustritte erreicht regelmäßig neue Höchststände, und inzwischen gehört weniger als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland noch einer der beiden großen christlichen Kirchen an. Diese Entwicklungen sind gut dokumentiert, unter anderem durch die Evangelische Kirche in Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz. Unabhängig von einzelnen Schwankungen ist der Trend stabil: institutionelle Religiosität nimmt deutlich ab.
Dabei geht es nicht nur um Mitgliedszahlen. Mit dem Rückgang kirchlicher Bindung verliert Religion auch an öffentlicher Sichtbarkeit und normativer Autorität. Kirchen prägen gesellschaftliche Debatten weniger stark, religiöse Argumente gelten zunehmend als partikular oder erklärungsbedürftig, nicht mehr als selbstverständlicher Teil des öffentlichen Diskurses. Religion rückt – zumindest institutionell – an den Rand.
Diese Verschiebung lässt sich nicht nur im kirchlichen Bereich beobachten, sondern auch symbolisch im politischen Raum. Selbst Parteien, deren Identität historisch eng mit christlicher Soziallehre verbunden war, verhandeln immer wieder offen, welche Rolle religiöse Bezüge noch spielen sollten. Innerparteiliche Debatten innerhalb der Christlich Demokratischen Union Deutschlands darüber, ob das „C“ im Namen noch zeitgemäß sei oder zugunsten eines allgemein konservativen Profils an Bedeutung verlieren müsse, sind kein Beweis für gesellschaftliche Säkularisierung – aber ein aufschlussreiches Indiz für kulturelle Verschiebungen.
Zusammengenommen zeigt sich hier ein klares Bild: Säkularisierung ist real, messbar und institutionell wirksam. Kirchen verlieren Mitglieder, religiöse Referenzen verlieren Selbstverständlichkeit, und selbst vormals christlich geprägte Institutionen passen ihre Sprache an. Doch diese Entwicklung beantwortet noch nicht die Frage, was mit den Bedürfnissen nach Sinn, Ordnung und Deutung geschieht, die Religionen lange Zeit bearbeitet haben. Genau dort beginnt die zweite, oft übersehene Hälfte der Geschichte.
Das bleibende Bedürfnis nach Sinn und Transzendenz
So eindeutig der Rückgang institutioneller Religiosität ist, so trügerisch wäre der Schluss, damit verschwinde auch das Bedürfnis nach Sinn, Transzendenz und Deutung von Endlichkeit. Empirische Studien zeichnen seit Jahren ein differenzierteres Bild: Viele Menschen lösen sich von Kirchen – nicht aber von Fragen nach Ordnung, Schutz, Schicksal oder einem „Mehr“ hinter der sichtbaren Welt.
Befragungen des Institut für Demoskopie Allensbach zeigen immer wieder, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung an Schutzengel, an ein höheres Schicksal, an kosmische Zusammenhänge oder an astrologische Deutungen glaubt. Diese Vorstellungen sind dabei keineswegs auf kirchlich gebundene Milieus beschränkt. Im Gegenteil: Sie finden sich gerade auch bei Menschen, die sich selbst als nicht religiös bezeichnen oder keiner Kirche mehr angehören.
Analytisch ist das aufschlussreich, weil es eine verbreitete Gleichsetzung infrage stellt: weniger Religion gleich weniger Spiritualität. Tatsächlich scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein. Sinnfragen bleiben präsent, sie werden aber individueller, fragmentierter und institutionell entkoppelt verhandelt. Transzendenz wird nicht mehr vermittelt, sondern zusammengesetzt; sie folgt weniger tradierten Lehren als persönlichen Bedürfnissen nach Orientierung, Halt und Erklärung.
An dieser Stelle wird deutlich, warum die Rede von einer vollständig säkularisierten Gesellschaft zu kurz greift. Was verschwindet, sind nicht die existenziellen Fragen, sondern die Orte, an denen sie kollektiv, reflektiert und widersprüchlich bearbeitet werden. Die Entkopplung von Sinn und Institution erzeugt kein Vakuum an Bedeutung – wohl aber ein Vakuum an Einordnung, Begrenzung und Verantwortung. Genau dieses Vakuum bildet den Übergang zur nächsten Beobachtung: der Wanderung religiöser Semantik in andere gesellschaftliche Felder.
Bedeutungswanderung: Wenn Sinn seine Orte wechselt
Setzt man die beiden bisherigen Beobachtungen zusammen, ergibt sich ein Muster, das für das Verständnis der aktuellen Debatten zentral ist: Während institutionelle Religion an Bindungskraft verliert, bleiben Sinn- und Deutungsbedürfnisse bestehen. Was sich verändert, ist nicht das Bedürfnis selbst, sondern der Ort, an dem es bearbeitet wird. Sinn verschwindet nicht – er wandert.
Diese Bedeutungswanderung lässt sich in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern beobachten. Politische Narrative, technologische Zukunftsvisionen oder geopolitische Deutungen greifen zunehmend auf Begriffe und Denkfiguren zurück, die lange Zeit religiös geprägt waren. Apokalyptische Szenarien, Erlösungsversprechen, Vorstellungen von Ordnung, Verfall oder notwendiger Reinigung strukturieren Argumentationen, ohne dass sie noch als religiös markiert wären.
Dabei geht es nicht um eine Rückkehr klassischer Religiosität. Die Begriffe werden nicht eingebettet, sondern funktional genutzt. Sie liefern Deutungsrahmen für Krisen, vereinfachen komplexe Entwicklungen und emotionalisieren politische Entscheidungen. Wo nüchterne Analysen an ihre Grenzen stoßen oder Unsicherheit erzeugen, bieten solche Semantiken Orientierung – oft schneller und wirksamer als differenzierte Erklärungen.
Gerade in Zeiten multipler Krisen ist diese Verschiebung anschlussfähig. Pandemie, Krieg, Klimawandel, ökonomische Unsicherheit und technologische Beschleunigung erzeugen ein permanentes Gefühl von Übergang und Gefährdung. Religiös aufgeladene Begriffe strukturieren diese Erfahrung, indem sie Anfang, Krise und möglichen Zusammenbruch erzählbar machen. Sie geben dem Unübersichtlichen eine Form.
Entscheidend ist dabei: Diese Bedeutungswanderung geschieht nicht zufällig, sondern dort, wo institutionelle Vermittlung fehlt. Wenn Kirchen als Orte kollektiver Sinnbearbeitung an Bedeutung verlieren, übernehmen andere Akteure diese Funktion – ohne jedoch an deren Tradition der Selbstbegrenzung, Ambivalenz und ethischen Reflexion gebunden zu sein. Genau an diesem Punkt beginnt das eigentliche Problem.
Das Problem der Verkürzung – und die Rückkehr christlicher Fragmente
Wenn religiöse Begriffe heute im politischen oder technologischen Diskurs auftauchen, kehren sie selten als geschlossene theologische Deutungen zurück. Was wiederkehrt, sind Fragmente: einzelne Motive, Bilder und Erzählkerne aus christlicher Tradition, gelöst aus ihrem Kontext und neu zusammengesetzt. Diese Fragmente sind anschlussfähig, weil sie vertraut wirken – und zugleich flexibel genug, um in ideologische Narrative eingebettet zu werden.
Besonders deutlich wird das dort, wo christliche Kategorien zur Deutung von Geschichte und Macht herangezogen werden. Der Tech-Unternehmer Peter Thiel greift seit Jahren explizit auf apokalyptische Motive, Opfer-Narrative und katechonische Denkfiguren zurück. Geschichte erscheint bei ihm als dramatischer Prozess, der auf Eskalation zuläuft und durch entschlossene Akteure aufgehalten oder gewendet werden müsse. Religiöse Begriffe fungieren dabei nicht als Gegenmacht zur Politik, sondern als deren Tiefenlegitimation.
Auch die politische Figur Donald Trump wird in Teilen dieser Diskurse nicht nur politisch, sondern heilsgeschichtlich aufgeladen. Trump erscheint als Retter einer bedrohten Ordnung, als Garant von Freiheit gegen Verfall. Bemerkenswert ist dabei, dass selbst Kritik an seiner Person – etwa an seinem Lebenswandel – innerhalb dieser Narrative religiös gerahmt wird: Nicht trotz, sondern gerade wegen seiner Widersprüchlichkeit könne er als Werkzeug in einem größeren, quasi göttlichen Plan gelesen werden. Klassische biblische Motive wie das unvollkommene Werkzeug oder der widerständige Erwählte werden so politisch funktionalisiert.
In all diesen Fällen geht es nicht um Religion im engeren Sinne. Es geht um die Selektivität der Übernahme. Aus komplexen theologischen Traditionen werden einzelne Versatzstücke isoliert: Apokalypse ohne Hoffnung, Erlösung ohne Ethik, Katechon ohne Selbstbegrenzung. Was verloren geht, ist die innere Spannung religiöser Begriffe – ihre Fähigkeit, Macht zu irritieren, statt sie zu stabilisieren.
Diese Verkürzung macht religiöse Semantik besonders wirksam. Sie erzeugt Sinn und Gewissheit, ohne sich der kritischen Rückbindung an Verantwortung, Schuld oder Vorläufigkeit stellen zu müssen. Christliche Erzählmuster kehren so nicht als Religion zurück, sondern als ideologisch aufgeladene Tiefenstruktur politischer Deutung.
An dieser Stelle ist wichtig festzuhalten: Diese Art des Denkens ist nicht neu. Die Verbindung von politischer Ordnung, theologischer Kategorie und geschichtlicher Dramatik hat eine lange Tradition. Sie wurde im 20. Jahrhundert systematisch ausgearbeitet – besonders deutlich bei Carl Schmitt, der den Katechon ausdrücklich als politische Denkfigur nutzte, um Ordnung gegen Chaos zu begründen.
Politische Relevanz und Gefährdung: Der Katechon als politische Denkfigur
Die Attraktivität religiöser Kategorien im politischen Diskurs lässt sich nicht allein aus aktuellen Krisen erklären. Sie hat eine ideengeschichtliche Tiefenschicht. Spätestens im 20. Jahrhundert wurde systematisch darüber nachgedacht, wie religiöse Begriffe politisch wirksam werden können – und einer der zentralen Referenzpunkte ist dabei Carl Schmitt.
Schmitt griff den Katechon ausdrücklich als politische Kategorie auf. Für ihn war der Katechon jene Macht, die den Zusammenbruch aufhält, Chaos verzögert und Geschichte in einer erträglichen Ordnung hält. Entscheidend ist dabei nicht die theologische Genauigkeit, sondern die politische Funktion: Ordnung erscheint nicht mehr als Ergebnis demokratischer Aushandlung, sondern als notwendiger Schutz vor dem Schlimmeren. Der Katechon legitimiert Macht, indem er sie als Bollwerk gegen den Untergang deutet.
Diese Denkfigur ist hoch anschlussfähig – gerade in Zeiten permanenter Krisenerfahrung. Sie erlaubt es, politische Akteure oder Ordnungen nicht nur als sinnvoll, sondern als existenziell notwendig darzustellen. Wer den Zusammenbruch aufhält, muss nicht mehr im gleichen Maß begründen, abwägen oder sich rechtfertigen. Kritik wird nicht widerlegt, sondern als verantwortungslos markiert, weil sie angeblich das Chaos beschleunigt.
Genau hier liegt die demokratietheoretische Brisanz. Die katechonische Logik verschiebt politische Konflikte auf eine existentielle Ebene. Es geht nicht mehr um bessere oder schlechtere Lösungen, sondern um Ordnung oder Untergang. Entscheidungen werden sakralisiert, ohne religiös zu sein. Politik verwandelt sich in eine Frage der Rettung – nicht der Gestaltung.
In dieser Logik lassen sich auch gegenwärtige Narrative einordnen, in denen politische Führungsfiguren oder technologische Eliten als letzte Garanten von Freiheit, Ordnung oder Zivilisation erscheinen. Religiöse Fragmente – Apokalypse, Erlösung, Erwählung – dienen dabei als Tiefenstruktur, nicht als offenes Bekenntnis. Sie erzeugen Sinn und Dringlichkeit, ohne die selbstkritischen Gegengewichte religiöser Traditionen mitzunehmen.
Das Gefährliche daran ist nicht die Verwendung starker Bilder. Gefährlich ist die Verschiebung politischer Rationalität. Wo Politik katechonisch gedacht wird, schrumpft der Raum für Zweifel, Fehlerfreundlichkeit und Opposition. Demokratie aber lebt gerade davon, dass Ordnung nicht als Heilszustand verstanden wird, sondern als vorläufiges Ergebnis konflikthafter Aushandlung.
Verantwortung, Deutungshoheit – und die Notwendigkeit von Kritik
Wenn religiöse Fragmente in politische Ideologien wandern und dort Wirkmacht entfalten, stellt sich zwangsläufig die Frage nach Verantwortung. Nicht im Sinne von Schuldzuweisungen, sondern im Sinne von Deutungshoheit. Wer widerspricht, wenn religiöse Kategorien zur Legitimation von Macht werden? Und wer benennt die Verkürzungen, die dabei entstehen?
Kirchen geraten hier in eine ambivalente Rolle. Einerseits verlieren sie an institutioneller Bindungskraft und öffentlicher Autorität. Andererseits wären sie – gerade aufgrund ihrer theologischen Tradition – prädestiniert, auf die innere Spannung religiöser Begriffe hinzuweisen: auf Vorläufigkeit statt Gewissheit, auf Begrenzung statt Heilsversprechen. Wo diese Stimme ausbleibt oder sich auf innerkirchliche Debatten zurückzieht, entsteht ein Deutungsvakuum.
Doch Verantwortung liegt nicht allein bei religiösen Institutionen. Auch politische Akteure und Parteien können sich dieser Entwicklung nicht entziehen. Wenn religiöse Semantik aus Programmen, Selbstbeschreibungen und politischen Traditionen verschwindet, taucht sie andernorts wieder auf – häufig ungebremst und funktionalisiert. Die Frage, wie mit Sinn, Ordnung und Endlichkeit im politischen Raum umgegangen wird, bleibt damit bestehen, auch wenn sie nicht mehr explizit religiös verhandelt wird.
An dieser Stelle wird eine kritische Perspektive wichtig, wie sie etwa Theodor W. Adorno formuliert hat. Adorno warnte davor, halb verstandene Begriffe als bloße Versatzstücke zu verwenden. Das Fragment sei nicht die Vorstufe von Erkenntnis, sondern ihr Gegenteil, wenn es zur Ideologie gerinnt. Übertragen auf den gegenwärtigen Kontext bedeutet das: Die selektive Übernahme religiöser Kategorien erzeugt nicht mehr Tiefe, sondern Scheingewissheit. Sie verleiht politischen Narrativen einen Anschein von Sinn, ohne sich der kritischen Prüfung auszusetzen, die mit diesen Begriffen ursprünglich verbunden war.
Genau hier liegt eine zentrale Aufgabe politischer Bildung und gesellschaftlicher Aufklärung. Nicht darin, Religion zu rehabilitieren oder zu delegitimieren, sondern darin, sichtbar zu machen, wie Sinnangebote funktionieren, woher ihre Begriffe stammen und was verloren geht, wenn sie aus ihrem Zusammenhang gelöst werden. Kritik heißt in diesem Sinne nicht Entzauberung um jeden Preis, sondern Rückgewinnung von Differenz, Ambivalenz und Widerspruch.
Schluss: Drei Konsequenzen
Wenn religiöse Denkfiguren in einer scheinbar säkularen Welt zurückkehren, ist das kein Betriebsunfall der Moderne. Es ist Ausdruck eines fortbestehenden Bedürfnisses nach Sinn, Ordnung und Orientierung – gerade in Zeiten tiefgreifender Verunsicherung. Problematisch wird diese Rückkehr nicht durch die Suche nach Sinn selbst, sondern durch die Formen, in denen sie politisch und ideologisch funktionalisiert wird.
Aus dieser Beobachtung lassen sich drei Konsequenzen ableiten.
- Sinn analytisch ernst nehmen – ohne ihn normativ zu bestätigen
Für politische Bildung, Prävention und Analyse bedeutet das zunächst, Sinnfragen nicht zu marginalisieren. Radikalisierungsprozesse lassen sich nicht verstehen, wenn man religiöse oder spirituelle Deutungen ausschließlich als irrational oder falsch behandelt. Entscheidend ist nicht ihre theologische Richtigkeit, sondern ihre soziale Wirksamkeit: was sie emotional, existenziell und symbolisch leisten. Sinn muss analytisch ernst genommen werden – ohne ihn zu sakralisieren oder politisch zu legitimieren.
- Religiöse Begriffe kontextualisieren – statt sie sich selbst zu überlassen
Wo religiöse Kategorien wie Apokalypse, Erlösung oder Katechon aus ihren Zusammenhängen gelöst werden, entstehen Verkürzungen. Diese sind nicht neutral, sondern politisch wirksam. Gerade deshalb braucht es öffentliche Einordnung: nicht im Sinne theologischer Belehrung, sondern als Sichtbarmachung von Ambivalenzen, Begrenzungen und inneren Spannungen. Religiöse Begriffe entfalten ihre kritischste Kraft dort, wo sie Macht relativieren – nicht dort, wo sie sie absichern.
- Ideologischen Verkürzungen widersprechen – ohne Moralismus
Schließlich braucht es Widerspruch, wo religiöse Fragmente zur Legitimation von Ordnung, Autorität oder Ausschluss genutzt werden. Dieser Widerspruch sollte nicht empört, sondern analytisch sein. Es geht darum, aufzuzeigen, was ausgelassen wird, wenn komplexe Traditionen auf einfache Sinnformeln reduziert werden. In diesem Sinne bleibt die Warnung von Theodor W. Adorno aktuell: Das halb Verstandene ist nicht Vorstufe von Erkenntnis, sondern ihr Gegenteil, wenn es zur Ideologie gerinnt.
Vielleicht ist es deshalb weniger überraschend, dass religiöse Muster zurückkehren. Überraschender ist, wie wenig reflektiert diese Rückkehr oft geschieht. Der kritische Umgang mit Sinnangeboten ist keine theologische Spezialfrage, sondern eine demokratische Aufgabe. Nicht, um Sinn zu entwerten – sondern um zu verhindern, dass er zur Rechtfertigung von Macht wird.