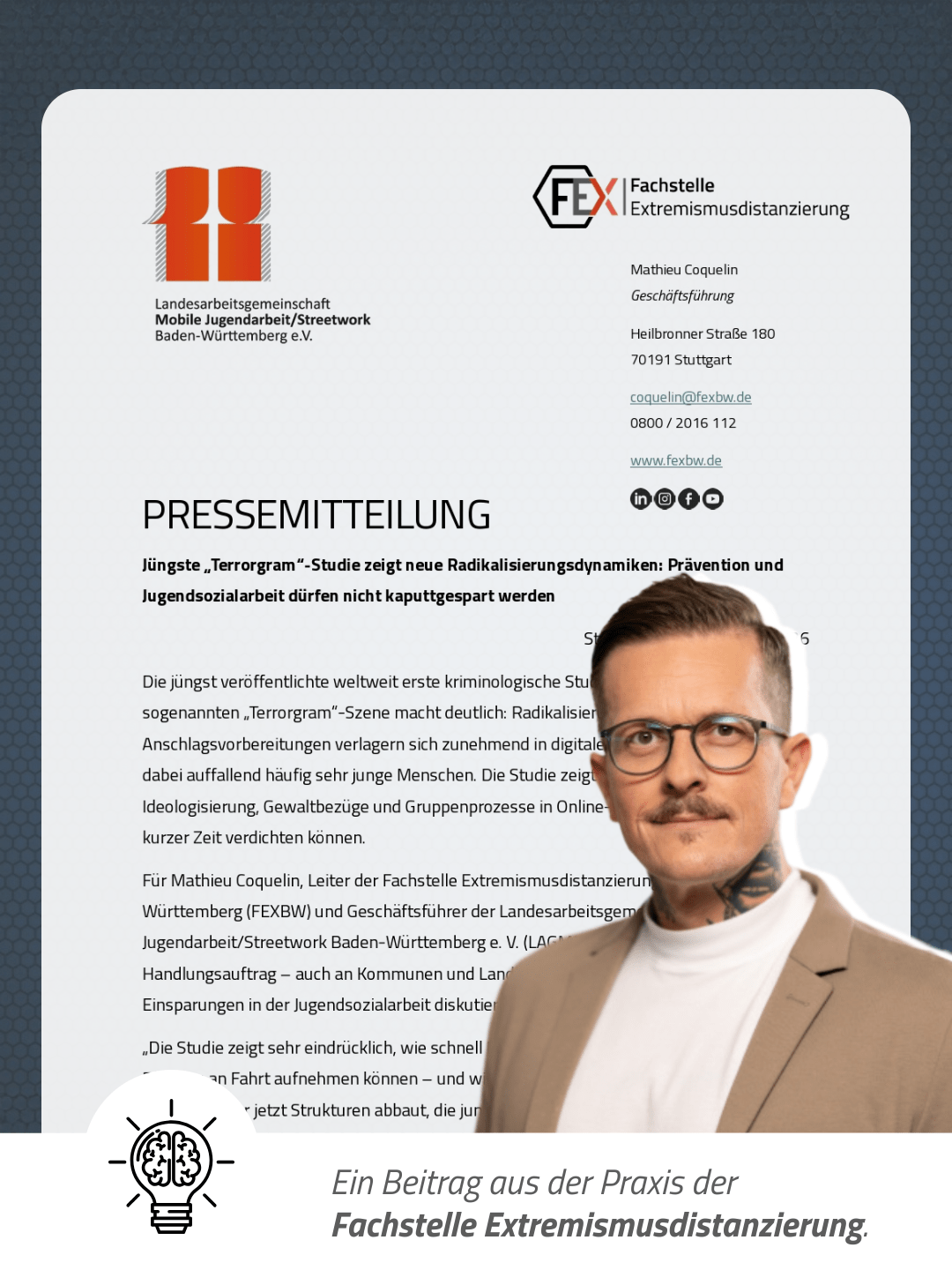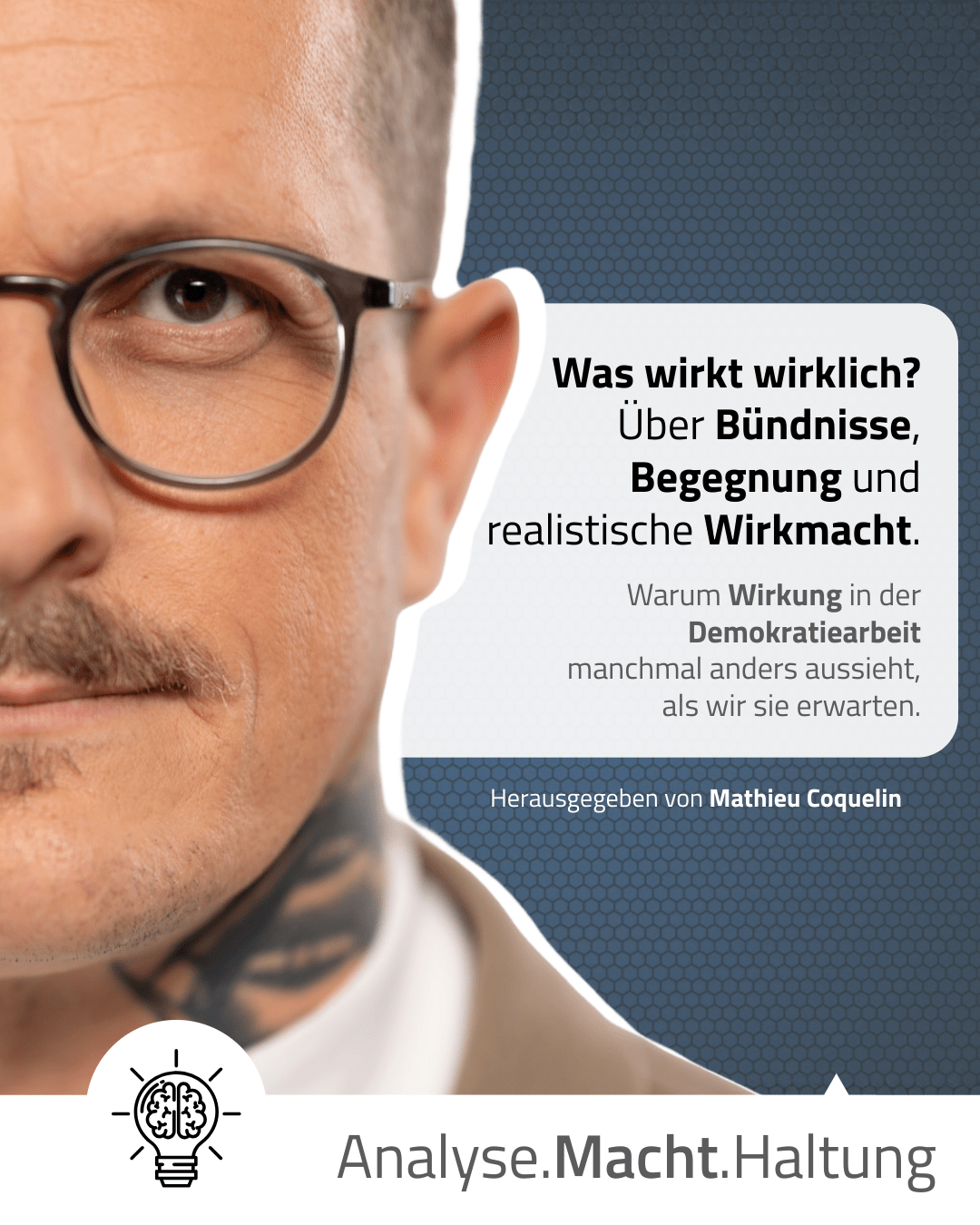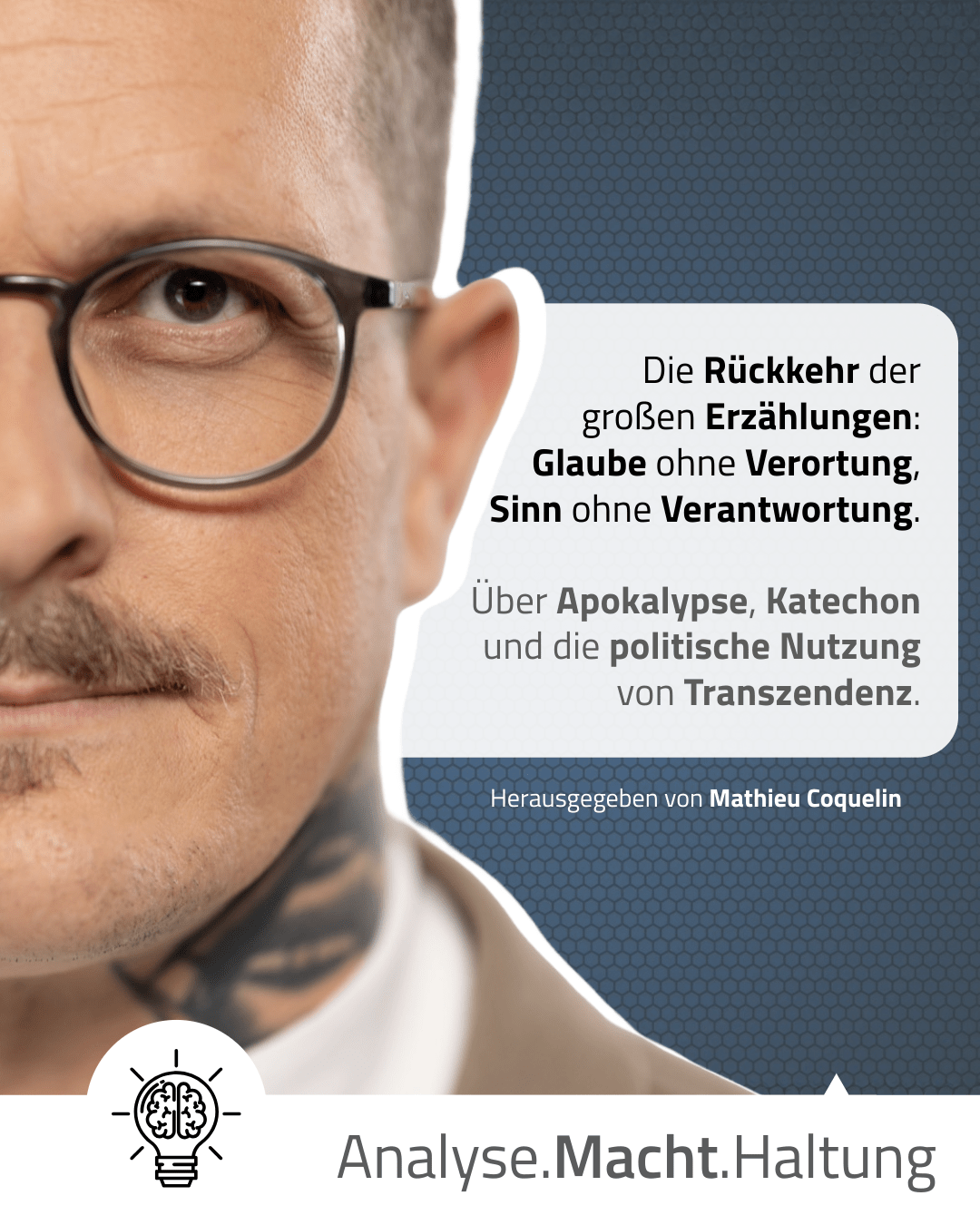Palmer, Intelligenz und die Normalisierung der AfD – eine Analyse
1. Warum ich jetzt doch über Palmer schreibe
Eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, nichts zu Boris Palmer und seiner Teilnahme an einem AfD-Format zu schreiben.
Und jetzt ist dies schon der zweite Artikel, in dem ich gegen meinen eigenen Vorsatz verstoße.
Warum?
Weil sich an solchen Auftritten immer das gleiche Problem zeigt: Man redet zwar über Palmer – aber vor allem redet man über die AfD. Jede zusätzliche Aufmerksamkeit verstärkt am Ende deren Wirkung.
Und dann bin ich in einem Kommentarstrang hängen geblieben. Ein Nutzer schrieb:
»Das einzig Positive an diesem dämlichen Ansatz, mit der AfD debattieren zu wollen, ist noch, dass Palmer wenigstens intelligent ist.«
Eine kleine Randbemerkung – und doch hat sie mich nachdenklich gemacht.
Denn plötzlich drehte sich die Diskussion nur noch um die Frage: Hilft es, wenn Palmer „intelligent“ ist – oder ist Markus Frohnmaier im Gegenteil „saudumm“?
Aber ist am Ende nicht weder das eine noch das andere entscheidend darüber, welche Wirkung von so einem Format ausgeht?
Genau das möchte ich in diesem Artikel aufgreifen.
Nicht, weil Palmer „intelligent“ ist oder nicht.
Sondern weil die Frage uns auf eine grundlegende Spur führt:
- Warum Intelligenz kein Wert an sich ist.
- Warum Moral-Debatten genauso leicht ins Leere laufen.
- Und warum wir am Ende auf die Ebene von Rechtsstaatlichkeit und demokratiepraktischen Folgen schauen müssen.
2. Drei Begriffe, drei Ebenen: Intelligenz – Wissen – Moral
Wenn wir über Palmer, Frohnmaier oder andere reden, dann stolpern wir schnell über Worte wie „intelligent“, „ungebildet“ oder „moralisch fragwürdig“. Oft werfen wir diese Begriffe durcheinander – dabei gehören sie auf unterschiedliche Ebenen.
Intelligenz beschreibt die Fähigkeit, schnell Muster zu erkennen, Probleme zu lösen, neue Informationen aufzunehmen. Sie ist in gewisser Weise ein Beschleuniger. Menschen mit hoher Intelligenz haben es leichter, Wissen anzueignen, in Erinnerung zu behalten und in neue Kontexte zu übertragen. Oft schlägt sich das auch in Bildungswegen oder beruflichen Erfolgen nieder.
Wissen hingegen ist der Vorrat an Informationen und Erfahrungen, den wir im Laufe der Zeit sammeln. Wissen wächst, wenn man es nutzt, und kann verloren gehen, wenn es nicht gepflegt wird. Intelligenz kann diesen Prozess erleichtern – aber es sind nicht dieselben Kategorien.
Und dann gibt es noch die Moral. Sie beantwortet nicht die Frage, wie klug oder wie belesen jemand ist, sondern die Frage: Wofür setze ich meine Fähigkeiten und mein Wissen ein?
Das macht den entscheidenden Unterschied:
- Intelligenz kann problematische Ziele nur wirksamer verfolgen.
- Wissen allein garantiert nicht, dass es zum Guten eingesetzt wird.
- Erst die moralische Orientierung gibt einen Maßstab dafür, ob Handeln legitim ist oder nicht.
Darum ist es am Ende ein Kategorienfehler, wenn wir fragen: „Hilft es, wenn Palmer intelligent ist?“ oder „Schadet es, wenn Frohnmaier dumm ist?“ Die Antwort lautet: Weder das eine noch das andere entscheidet darüber, welche Wirkung von einem Format ausgeht.
3. Warum Moral-Debatten uns auch nicht weiterbringen
Wenn Intelligenz und Wissen keine Auskunft darüber geben, ob ein Handeln gut oder schlecht ist, dann rückt die Moral in den Vordergrund. Doch auch hier wird es kompliziert.
Moralische Fundamente – gleiche Kategorie, andere Gewichtung
Der Sozialpsychologe Jonathan Haidt beschreibt in seinem Buch The Righteous Mind, dass Menschen ihr moralisches Urteil auf sechs Grundpfeiler stützen. Diese „Moralfundamente“ sind nicht gleich verteilt, sondern werden in unterschiedlichen politischen Lagern verschieden stark gewichtet.
Bei progressiven Milieus stehen meist drei Fundamente im Zentrum:
- Fürsorge: Leid vermeiden, Mitgefühl zeigen, andere schützen.
- Fairness: Gerechtigkeit sichern, gleiche Chancen schaffen, Betrug verhindern.
- Freiheit: Selbstbestimmung wahren, Unterdrückung zurückweisen.
Bei konservativen und nationalpopulistischen Milieus treten andere drei Fundamente stärker hervor:
- Loyalität: Bindung an Familie, Gemeinschaft, Nation.
- Autorität: Respekt vor Regeln, Institutionen, Hierarchien.
- Reinheit: Vorstellungen von Anstand, Ordnung, kultureller Homogenität.
Alle sechs sind moralische Kategorien – sie unterscheiden sich nicht darin, ob sie „moralisch“ sind, sondern darin, welche Werte sie priorisieren.
Das heißt: Auch Anhänger:innen der AfD haben Moral. Ihre Orientierung ist nicht die Abwesenheit von Moral, sondern eine Gewichtung anderer Fundamente. Manchmal gibt es Überschneidungen mit progressiven Vorstellungen – zum Beispiel beim Thema Fairness, allerdings mit anderer Definition dessen, wer dazugehört. Oft aber führen die unterschiedlichen Gewichtungen zu Frontstellungen.
Genau deshalb sind Moraldebatten so unergiebig. Wenn jede Seite aus ihrem Fundament heraus urteilt, dann erlebt sich die eine als „moralisch überlegen“ und die andere als „moralisch verachtet“. Das Ergebnis ist keine Verständigung, sondern das nächste gegenseitige Etikett: hier „moralisch verkommen“, dort „moralisch überheblich“.
So werden Gräben nicht kleiner, sondern tiefer. Und auch das lenkt uns ab von der eigentlichen Frage: Welche Wirkung haben Formate, in denen Parteien wie die AfD auftreten?
Zwischenfazit
Bis hierher lässt sich festhalten: Die Frage, ob es „klug“ oder „dumm“ ist, sich mit jemandem wie Markus Frohnmaier auf ein Format einzulassen, führt uns in die Irre. Denn sie verschiebt den Blick von der eigentlichen Wirkung hin auf Eigenschaften von Personen.
Das Problem dabei ist zweifach:
- Erstens: Wir übertragen schnell unsere Zuschreibungen über die Protagonisten auch auf deren Wähler:innen. Wer Frohnmaier für „grunddumm“ erklärt, erklärt damit leicht auch die, die ihn wählen, für „grunddumm“. Das aber sind Bürger:innen mit Wahlrecht – und das gegenseitige Absprechen von Verstand bringt uns nicht näher zusammen.
- Zweitens: Intelligenz oder Wissen sagen nichts darüber, ob etwas gut oder schlecht ist. Dafür bräuchten wir die moralische Ebene.
Aber auch dort landen wir in einer Sackgasse: Denn Moral ist nicht einheitlich. Rechte wie linke Milieus stützen sich auf moralische Fundamente – nur mit unterschiedlicher Gewichtung. Wer also meint, die eine Seite habe „keine Moral“, verkennt, dass es vielmehr unterschiedliche Moralsysteme sind. Auch das trägt wenig dazu bei, Gräben zu überbrücken.
Damit stellt sich die Frage: Wenn weder Intelligenz noch Moral uns helfen, was bleibt dann? Genau an dieser Stelle setzt der letzte Teil an – die rechtsstaatliche Perspektive. Denn hier liegt der Maßstab, der nicht von Zuschreibungen abhängt, sondern auf klaren Kriterien beruht: Welche Wirkung haben solche Formate für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit?
4. Rechtsstaat & demokratiepraktische Wirkung
Streit gehört zur Demokratie. Manchmal ist er hart, manchmal ist er sogar amüsant – für viele von uns fast so unterhaltsam wie ein Boxkampf. Wir sehen, wie Argumente hin- und herfliegen, wie jemand punktet, wie jemand ins Straucheln gerät. Und insgeheim genießen wir es manchmal sogar, wenn ein Schlag unter die Gürtellinie geht.
Solange sich alle Beteiligten an die gemeinsamen Regeln halten, ist das kein Problem. Im Gegenteil: Politischer Streit hat dann einen Mehrwert. Denn wer sich offen begegnet, kann nicht nur seine eigene Position schärfen, sondern im besten Fall auch erkennen, wo es gute Gründe gibt, den eigenen Standpunkt zu überdenken. Genau dafür braucht es Intelligenz – die Fähigkeit, aus neuen Informationen zu lernen.
Aber all das funktioniert nur unter einer Bedingung: Alle Akteure müssen bereit sein, die Spielregeln der freiheitlich-demokratischen Grundordnung einzuhalten.
Und hier liegt der Knackpunkt. Die AfD ist keine „normale“ Partei. Das zeigen die Einschätzungen der Verfassungsschutzbehörden, die Vielzahl an Gutachten, die Verfahren und Gerichtsurteile, und nicht zuletzt die zahlreichen Fälle von Mitarbeitern mit extremistischen Verbindungen oder sogar Straftaten. Trotzdem scheint genau diese Erkenntnis noch nicht überall angekommen zu sein.
Das bedeutet: Mit der AfD greifen die normalen Regeln nicht. Streit mit einer Partei, die die Spielregeln der Demokratie selbst infrage stellt, führt nicht mehr zu Lernprozessen, sondern zu Verschiebungen – in Wahrnehmung und im Diskursrahmen.
Drei Mechanismen der Verschiebung
Diese Verschiebungen laufen über drei ineinandergreifende Mechanismen: Normalisierung, Opfernarrativ und Polarisierung.
Ein Beispiel dafür findet man in Kommentarspalten:
- Anhänger schreiben nach solchen Formaten stolz: „Seht ihr, wir sind Teil des Spiels!“
- Gegner klagen frustriert: „Warum stoppt das niemand?“
- Unentschiedene kommentieren: „So schlimm kann die AfD ja nicht sein, wenn Palmer mitmacht.“
Das zeigt, wie dieselbe Bühne drei sehr unterschiedliche Dynamiken befeuert – und am Ende die AfD stärkt.
Um das greifbar zu machen, lohnt es sich, drei Gruppen zu unterscheiden:
- Sympathisierende
- Sie fühlen sich bestätigt.
- Das Format zeigt ihnen: „Unsere Partei gehört dazu.“
- Die Kritik im Vorfeld oder Nachgang bestärkt ihr Gefühl, verfolgt zu werden.
- Ergebnis: Verfestigung ihrer Haltung, Abgrenzung vom „Mainstream“.
- Gegner:innen
- Sie erleben Ohnmacht: „Warum versteht das niemand? Warum stoppt das niemand?“
- Ihre Ablehnung wird bestätigt, aber ohne praktische Konsequenz.
- Frust und Rückzug sind die Folge.
- Ergebnis: Polarisierung vertieft sich, die Fronten verhärten.
- Unentschiedene
- Für sie entsteht der Eindruck: „Wenn die AfD bei solchen Formaten mitmacht, scheint sie doch Teil des normalen Betriebs zu sein.“
- Kritik wirkt schnell wie Übertreibung oder Vorverurteilung.
- Ergebnis: Verschiebung in Richtung Akzeptanz, was wiederum die gesellschaftliche Spaltung verstärkt.
Das ist der Kern: Nicht Intelligenz, nicht Moral, sondern die Frage nach der Anerkennung der Spielregeln entscheidet. Und solange diese Anerkennung fehlt, verstärkt jedes Format die Normalisierung der AfD, füttert ihr Opfernarrativ – und treibt die Polarisierung der Gesellschaft weiter voran.
5. Fazit: Die eigentliche Frage
Was bleibt also von dieser ganzen Debatte?
Zunächst: Es lohnt sich nicht, die Frage nach Intelligenz oder Dummheit zu stellen. Denn Intelligenz und Wissen sind Kategorien, die für sich genommen nichts darüber aussagen, ob Ziele und Mittel demokratieverträglich sind. Und auch Moraldebatten führen uns nicht weiter – sie verhärten Fronten, weil jede Seite ihre eigenen Fundamente hat.
Entscheidend ist am Ende etwas anderes: Ob Akteure bereit sind, die Spielregeln des demokratischen Streits einzuhalten. Und genau hier zeigt sich: Mit der AfD haben wir es nicht mit einer normalen Partei zu tun. Formate, die diesen Eindruck erwecken, leisten drei Dinge gleichzeitig: Sie normalisieren, sie stärken das Opfernarrativ – und sie treiben die Polarisierung der Gesellschaft voran.
Darum ist die eigentliche Frage nicht, ob Palmer intelligent oder Frohnmaier dumm ist.
Die Frage lautet: Wollen wir riskieren, dass die Bühne, die man ihnen gibt, genau jene Mechanismen stärkt, die unsere Demokratie schwächen?