
Vom Missstand zur Gewalt? Radikalisierung verstehen – und warum Demokratie die Antwort sein kann
Vom Begriff zur Praxis
Im ersten Teil dieser Reihe haben wir uns dem Begriff „Ideologie“ angenähert – nicht als Schlagwort, sondern als analytisches Werkzeug. Wir haben sogar gewagt, ihn auf die Demokratie selbst anzuwenden, um ihre Idee der Gleichwertigkeit klarer sichtbar zu machen.
Dieser zweite Teil richtet sich bewusst nicht nur an Fachleute, sondern an alle, die verstehen wollen, wie Radikalisierung entsteht – und wie Ideologien dabei wirken. Wir greifen dafür auf Modelle zurück, die seit Jahren in unserer Präventionspraxis genutzt werden. Sie beschreiben Radikalisierung als Prozess: vom scheinbaren Nullpunkt bis hin zur Gewalt. Doch genau darin steckt ein Dilemma:
- Ab wann beginnt dieser Prozess überhaupt?
- Für wen wird er ab welchem Punkt problematisch?
- Und wie erklären wir Entwicklungen, die nicht in Gewalt münden, aber trotzdem das gesellschaftliche Klima verändern?
Viele Modelle konzentrieren sich auf Radikalisierung in Gewalt. Wir wollen den Blick erweitern:
- Wie wirkt Ideologie in den Graubereichen davor?
- Wie können auch Menschen, die selbst nie Gewalt anwenden würden, durch Sprache und Zuschreibungen Prozesse verstärken?
- Und was bringt uns dabei das Gedankenexperiment, Demokratie als Ideologie zu verstehen?
Vielleicht eröffnet genau dieser Perspektivwechsel einen neuen Zugang, Radikalisierung nicht nur zu erklären, sondern ihr im Alltag wirksamer begegnen zu können.
Das „Terrorist Mindset“-Modell nach Borum: Wie aus Missstand und Ungerechtigkeit Gewalt entstehen kann
Wir wollen uns nun zwei Modellen des US-Radikalisierungsforschers Randy Borum genauer widmen, die in unserer Präventionspraxis eine wichtige Rolle spielen. Gerade in unseren Ansätzen findet das sogenannte „Terrorist Mindset“-Modell Anwendung. Es beschreibt nicht nur, wie Menschen Schritt für Schritt in extremistische Denkweisen hineinwachsen, sondern auch, wie Gewalt entsteht, die ideologisch begründet wird:
- Wahrnehmung eines Missstands – etwas in der Gesellschaft ist falsch, ungerecht, schief.
- Erleben von Ungerechtigkeit – der Missstand wird persönlich relevant, er resoniert.
- Externe Zuschreibung – Schuldige werden benannt, Verantwortlichkeiten konstruiert.
- Entmenschlichung – die benannte Gruppe wird nicht mehr als gleichwertig behandelt, sondern abgewertet, bis hin zur Legitimation von Gewalt.
Missstand und Ungerechtigkeit: Vom abstrakten Problem zur persönlichen Betroffenheit
Stellen Sie sich eine einfache Szene vor:
Ich frage in einem Workshop, wer dafür ist, dass Frauen grundsätzlich schlechter behandelt werden als Männer. Wer zustimmt soll die Hand heben?
Was passiert, ist immer gleich: Niemand meldet sich. Vielleicht kichert jemand verlegen, vielleicht dreht sich jemand um. Aber die Hände bleiben unten.
Analysieren wir das: Die Gruppe hat sich eben – unausgesprochen, aber deutlich – auf etwas verständigt. Dort, wo Frauen schlechter behandelt werden als Männer, liegt ein Missstand vor. Das ist der erste Schritt im Borum-Modell: die Wahrnehmung einer Schieflage.
Doch ein Missstand allein führt noch nicht zur Handlung. Der zweite Schritt braucht ein anderes Element: Ungerechtigkeit. Dafür muss das Thema in mir „mitschwingen“. Ich benutze in Workshops gern die Metapher des Resonierens: Erst wenn etwas in meiner eigenen Lebenswelt eine Saite zum Schwingen bringt, wird aus dem abstrakten Missstand eine Ungerechtigkeit, die ich nicht mehr ignorieren kann.
Bleiben wir im Beispiel: Wer kämpft konkret gegen die Benachteiligung von Frauen? Meist sind es vor allem Frauen selbst, die diese Ungerechtigkeit erleben. Männer tun es, wenn sie einen persönlichen Zugang haben: als Väter von Töchtern, durch Bildung und Auseinandersetzung – oder durch konkrete Situationen wie sexuelle Übergriffe oder Catcalling, bei denen sie eingreifen.
Das Entscheidende: Zwischen Missstand und Ungerechtigkeit liegt noch kein Extremismus. Und auch keine Demokratiefeindlichkeit. Aber wir sehen: Menschen handeln, weil ein Thema bei ihnen resoniert. Dieses Handeln kann klein sein – ein Post in sozialen Medien – oder groß – Engagement in einer Bewegung. Für Prävention heißt das: Wir müssen ernst nehmen, dass nicht jede Ungerechtigkeit für alle dieselbe Resonanz hat.
Warum ein „altes“ Modell aktueller ist denn je
Manche mögen fragen: Warum greifen wir für die Analyse auf ein Modell zurück, das schon vor zwei Jahrzehnten entwickelt wurde?
Die Antwort: Weil es die Grundlogik beschreibt, wie Ungerechtigkeit in Gewalt kippen kann – und diese Logik ist heute aktueller denn je.
Vor 20 Jahren musste eine Ungerechtigkeit noch analog resonieren: Sie musste in der eigenen Familie, Nachbarschaft oder im persönlichen Umfeld spürbar sein, bevor sie ins Handeln führte. Heute genügt oft der digitale Raum: Social Media ermöglicht es, Erfahrungen – oder Behauptungen – in Sekunden global zu teilen und Resonanz herzustellen.
Das hat zwei Seiten:
- Konstruktiv: Betroffene von Diskriminierung können ihre Erfahrungen sichtbar machen, sich vernetzen und Kraft daraus ziehen, dass sie nicht allein sind. Hier leistet Social Media einen unschätzbaren Dienst.
- Gefährlich: Genau dieselben Mechanismen nutzen Akteure, um Ungerechtigkeiten zu instrumentalisieren oder zu konstruieren.
- In der Ansprache dschihadistischer Gruppen etwa wurden reale Rassismuserfahrungen aufgegriffen und politisch umgedeutet.
- Populistische Narrative wie „die Ausländer nehmen uns die Jobs“ oder „Geflüchtete bekommen mehr als Einheimische“ funktionieren ähnlich: Sie erzeugen Resonanz – nicht weil ein persönliches Erlebnis vorhanden wäre, sondern weil ein gefühlter Missstand algorithmisch verstärkt wird.
- Auch Neiddebatten über Bürgergeld-Empfänger illustrieren, wie schnell kollektive Zuschreibungen aus Ungerechtigkeitsnarrativen entstehen können, obwohl die persönliche Betroffenheit oft fehlt.
So zeigt das Modell: Es beschreibt nicht nur individuelle Radikalisierung, sondern auch kollektive Dynamiken – verstärkt durch digitale Filterblasen, algorithmische Logik und Echokammern.
Vom Resonanzraum zum Handlungsdruck
Resonanz allein bleibt selten folgenlos. Wenn eine Ungerechtigkeit in mir mitschwingt, entsteht meist auch ein Handlungsdruck: das Gefühl, etwas tun zu müssen.
Früher bedeutete das oft ein hohes Maß an Engagement – etwa sich einer Initiative anzuschließen, auf die Straße zu gehen oder Zeit und Geld zu investieren. Heute beginnt Handeln schon viel kleiner:
- einen Post liken,
- einen Kommentar schreiben,
- einem Kanal folgen,
- eine Nachricht weiterleiten,
- einen Hashtag verwenden.
All das sind niedrigschwellige Formen von Handlung, die jedoch eine enorme Wirkung entfalten können. Denn sie erzeugen sichtbare Reaktionen: Likes, Retweets, geteilte Storys. Jede dieser Rückmeldungen verstärkt das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein – und kann so den Schritt vom bloßen Empfinden einer Ungerechtigkeit hin zu einem stabilisierten Narrativ beschleunigen.
Problematisch ist dabei, dass diese Rückmeldungen nicht neutral sind. Sie werden von Algorithmen gesteuert, die primär auf Reichweite, Verweildauer und Werbeeinnahmen optimiert sind. Was mehr Emotion auslöst – Empörung, Wut, Angst –, hat eine größere Chance, gesehen zu werden. Das bedeutet:
- Inhalte, die Missstände dramatisieren, finden leichter Resonanz.
- Handlungen, selbst kleine, werden sichtbar belohnt.
- Und Engagement, das Empörung verstärkt, wird algorithmisch bevorzugt.
So entsteht eine Dynamik, in der die Übergänge zwischen Ungerechtigkeit, Schuldzuweisung und Entmenschlichung beschleunigt werden – nicht, weil sich die Logik des Modells überholt hätte, sondern weil die digitale Infrastruktur selbst zum Verstärker wird.
Vom Resonanzraum zum Handlungsdruck – und zur situativen Wahrnehmung
Neben Resonanz und Handlungsdruck gibt es ein drittes Element, das in der Praxis immer wichtiger wird: die Verschiebung des Situativen.
Im Analogen war Ungerechtigkeit oft an konkrete Erlebnisse gebunden: ein sexistischer Witz, ein diskriminierender Kommentar, eine erlebte Ungleichbehandlung. Menschen griffen situativ ein – weil sie selbst betroffen waren oder weil das Erlebte unmittelbar präsent war.
Durch Social Media verändert sich dieses Muster. Digitale Plattformen machen Ereignisse sichtbar, die weit entfernt passieren – und doch so wirken, als seien sie im eigenen Umfeld.
Ein Beispiel: Nach der Ermordung von George Floyd im Mai 2020 gaben Jugendliche in Workshops an, Angst zu haben, in einer deutschen Polizeikontrolle ihr Leben zu verlieren. Ereignisse aus den USA, die reale Missstände markieren, wurden in sozialen Netzwerken millionenfach geteilt – und so unmittelbar präsent, dass sie in deutschen Städten als eigene Realität empfunden wurden. Kolleg:innen aus der Mobilen Jugendarbeit berichteten, dass dieses Stimmungsbild ein wesentlicher Resonanzraum war, der in die Eskalation der Stuttgarter Krawallnacht hineinwirkte.
Das zeigt:
- Social Media verstärkt nicht nur Handlungsdruck durch ständige Rückmeldungen,
- sondern auch die Präsenz von Situationen, die ohne digitale Dauerverfügbarkeit gar nicht im Alltag erlebt würden.
- Ungerechtigkeiten werden so globalisiert – und oft ungefiltert in lokale Kontexte übertragen.
Damit schließt sich der Kreis zum Modell: Zwischen Missstand, Ungerechtigkeit und Handlungsoption verschiebt sich nicht die Logik, sondern die Geschwindigkeit und Intensität. Resonanz, Handlungsdruck und situative Wahrnehmung greifen ineinander – und beschleunigen Prozesse, die in früheren Zeiten deutlich länger gebraucht hätten.
Vom Resonanzraum zu Feindbildern: Externe Zuschreibung und Entmenschlichung
Nachdem wir nun die ersten Schritte im Borum-Modell eingeordnet haben – Missstand, Ungerechtigkeit, Handlungsdruck – wird sichtbar, was als Nächstes in den Fokus rückt: die externe Zuschreibung.
An diesem Punkt verschiebt sich der Blick: Nicht mehr das Problem selbst steht im Zentrum, sondern die Frage, wer dafür verantwortlich gemacht wird. Und hier kommen Ideologien besonders ins Spiel. Denn sie liefern ein ganzes Portfolio an Feindbildern:
- klassische antisemitische Erzählungen von einer „jüdischen Weltverschwörung“,
- rassistische Narrative über „kriminelle Migranten“ oder „Überfremdung“,
- antiziganistische Stereotype,
- patriarchale und nationalchauvinistische Deutungen über „natürliche“ Rollen oder „wahre Zugehörigkeit“.
Diese Feindbilder sind nicht zufällig, sondern handlungsleitend: Sie bieten einfache Erklärungen für komplexe Missstände. Und sie geben denen, die Resonanz verspüren, eine Richtung für ihr Handeln.
Das Problem: Je weniger plausibel ein Feindbild aus realistischer Perspektive ist, desto dysfunktionaler werden auch die Handlungsoptionen, die daraus erwachsen. Aus dem Gefühl, dass friedliche Aktionen „nichts bringen“, kann eine Dynamik entstehen, die Handlungen immer radikaler werden lässt – nicht unbedingt weil jemand Gewalt sucht, sondern weil alle „moderaten“ Mittel in der eigenen Wahrnehmung scheitern müssen, solange das Feindbild und vor allem die Ungerechtigkeit bestehen bleibt.
Stufe 3 und 4 im Blick
Randy Borum beschreibt diese Phase in zwei Stufen:
- Externe Zuschreibung – „Die da sind schuld“.
- Entmenschlichung – „Die da sind weniger wert.“
Gerade die vierte Stufe ist dabei kein linearer Endpunkt, sondern eher eine Verstärkungsschleife. In der Praxis beginnt Entmenschlichung oft schon mit der Feindbildzuschreibung: „Die sind nicht wie wir“, „Die passen nicht hierher“, „Die bedrohen uns“. Mit jeder Wiederholung wird die Abwertung intensiver – und die Legitimation für härtere Mittel steigt.
Ich kritisiere in Vorträgen deshalb immer, dass die Stufe nicht nur „Entmenschlichung“ heißen sollte, sondern eher „entmenschlicht“ Entmenschlichung ist nicht der letzte Schritt, sondern der Kitt, der alle Schritte miteinander verbindet.
So wird klar: Wir dürfen das Modell nicht linear lesen, sondern eher wie ein Mischpult. Die Regler für Ungerechtigkeit, Resonanz, Feindbilder und Entmenschlichung können gleichzeitig hoch- oder runtergedreht werden. Aber sobald die Entmenschlichung als innere Legitimation greift, sinkt die Hemmschwelle für Gewalt rapide.
Denn dann genügt es nicht mehr, Gewalt „irgendwie zu rechtfertigen“ – sie erscheint sogar als notwendig. Ob durch maximale Aufwertung des eigenen („wir sind die einzig Reinen“) oder maximale Abwertung der anderen („die sind Ungeziefer“, „die sind Parasiten“) – Entmenschlichung ist das rhetorische Bindemittel, das aus Ungerechtigkeit Gewalt macht.
Social Media als Verstärker von Zuschreibung und Entmenschlichung
Ein zusätzlicher Aspekt, den wir heute besonders beachten müssen, ist die Rolle von Social Media. Dort laufen die im Borum-Modell beschriebenen Prozesse nicht nur parallel, sondern überlagern sich – oft ohne klare Trennung.
In Filterblasen verstärken sich Resonanzräume, Feindbilder und Entmenschlichung gegenseitig. Missstände werden nicht nur benannt, sondern durch geteilte Bilder, Clips und Narrative permanent emotionalisiert. Die Trennlinien zwischen „Ungerechtigkeit“, „Feind“ und „Entmenschlichung“ verschwimmen.
Ein Beispiel dafür sind die hochgradig emotionalisierenden Bilder nach dem 7. Oktober. Sie transportieren nicht nur Ungerechtigkeit – sondern zugleich auch Gewalt. Und zwar in einer Weise, die oft gar nicht mehr unterscheidbar macht, wer diese Gewalt ausübt, wer sie inszeniert und wer sie verbreitet.
In der Wahrnehmung vieler verstärkt sich so das Gefühl, dass die eigene Gruppe permanent bedroht sei. Mit jedem neuen Bild wächst der Druck, dass „etwas getan werden muss“. Und mit diesem Druck steigt auch die sprachliche Eskalation:
- „Kriegsverbrechen“ scheint nicht mehr zu reichen.
- Neue Begriffe, härtere Vokabeln, stärkere Zuschreibungen müssen her.
- Jede Stufe sprachlicher Verrohung wirkt wie eine Vorstufe legitimer Gewalt.
Damit erklärt das Modell auch, warum Sprache selbst ein zentrales Feld der Prävention ist. Denn es geht nicht nur um jene, die am Ende zur Gewalt greifen. Entscheidend sind die sozialen Räume, in denen gewaltvolle Sprache normalisiert wird.
Wenn Abwertung und Entmenschlichung dort als Konsens erscheinen, bekommt der Einzelne, der zur Tat schreitet, das Gefühl, nicht allein zu handeln – sondern „für alle“. Gewalt erscheint dann nicht mehr als individueller Bruch, sondern als kollektive Konsequenz.
Zwischenfazit: Resonanz als Ansatzpunkt – Entmenschlichung als Daueraufgabe
Radikalisierung beginnt selten mit einem fertigen Weltbild. Sie beginnt dort, wo ein Missstand in uns resoniert – wo Ungerechtigkeit mitschwingt und Handlungsdruck erzeugt. Dieses Resonieren ist der Punkt, an dem Prävention am meisten bewirken kann.
Denn auf allen anderen Ebenen – den Plattformlogiken, den Filterblasen, der algorithmischen Verstärkung – ist der Handlungsspielraum begrenzt. Solange Konzerne nicht transparent reguliert werden, tragen soziale Medien erwiesenermaßen zur Emotionalisierung und zur Eskalationsspirale bei. Medienkompetenz bleibt wichtig – aber sie kann diese Strukturen nur bedingt ausgleichen.
Prävention heißt deshalb: Menschen befähigen, Missstände konstruktiv zu verarbeiten. Resonanz darf nicht ins Gefühl der Ohnmacht führen, sondern in handlungsfähige Wege, die Ungerechtigkeiten abbauen, statt neue Konflikte zu schaffen.
Zugleich gilt es, die Entmenschlichung neu zu denken. Sie ist nicht nur die „letzte Stufe“ eines Radikalisierungsprozesses, sondern durchzieht ihn von Anfang an. Feindbilder und Zuschreibungen greifen auf gesellschaftlich tradierte Stereotype zurück – rassistisch, antisemitisch, antiziganistisch, patriarchal oder nationalchauvinistisch. Sie prägen das „kollektive Unbewusste“ und wirken, lange bevor jemand zur Gewalt greift.
Wenn Prävention Erfolg haben will, muss sie hier ansetzen: bei den tief verankerten Vorurteilen, die Handlungsoptionen von Beginn an verzerren. Nur so lässt sich verhindern, dass Resonanz in Ohnmacht, Ohnmacht in Feindbild, und Feindbild in Gewalt umschlägt.
Damit steht am Ende dieses Abschnitts eine doppelte Botschaft:
- Radikalisierung ist weniger ein linearer Weg als ein Mischpult – an dem Resonanz, Zuschreibung und Entmenschlichung gleichzeitig lauter gestellt werden können.
- Prävention muss die Regler früh justieren – bei Resonanz und bei den Vorurteilen, die Entmenschlichung möglich machen.
Genau an dieser Stelle wird unser Gedankenexperiment aus Teil 1 wieder interessant: Wenn wir Demokratie als Ideologie verstehen – wie hilft uns das, Radikalisierung zu verhindern?
Demokratie als Ideologie – Resonanz ernst nehmen, Feindbilder verhindern
Wenn wir politische Auseinandersetzungen beobachten, fällt eines sofort auf: Es fehlt oft das Gespür für die Vielfalt von Ungerechtigkeits-Perspektiven, die in einem pluralen Rechtsstaat nebeneinander existieren. Noch weniger Bewusstsein gibt es für konstruierte Ungerechtigkeiten, die nur behauptet, nicht aber real sind.
Das Problem: Ohne diese Sensibilität geraten Diskussionen schnell ins Leere. Wer nicht versteht, worauf die Resonanz der anderen Seite gründet, kommuniziert nicht mehr konstruktiv, sondern produziert Abwehr.
Hier passt das Bild vom „nicht über jedes Stöckchen springen“. Natürlich ist es sinnvoll, Debatten nicht auf jede Provokation zu verengen. Aber zu übersehen, warum bestimmte Themen Resonanz erzeugen – auch wenn es um konstruierte Missstände geht – verhindert Verständigung von Anfang an.
Ein Beispiel: In Workshops erleben wir kaum jemanden, der für die generelle Schlechterbehandlung von Frauen plädiert. Der Konsens ist klar: Das wäre ein Missstand.
Anders beim Thema „Gendern“. Hier verschiebt sich der Fokus schnell – weg vom zugrunde liegenden Missstand (ungleiche Behandlung) hin zu einer Diskussion über Verfahren. Wer das Gendern ablehnt, wird dann nicht mehr als jemand wahrgenommen, der einen bestimmten Vorschlag zur Sprache kritisiert, sondern schnell als jemand, der Gleichwertigkeit insgesamt ablehnt.
Damit verschiebt sich die Logik:
- Aus einer inhaltlichen Differenz wird ein Feindbild.
- Aus einer Frage des Verfahrens wird ein Kampf um die Grundidee.
- Und genau das eröffnet, selbst jenseits von Extremismus, ein Radikalisierungspotenzial.
Ein praktischer Tipp aus der Präventionspraxis: Commitments bewusst machen.
Sich klar zu vergegenwärtigen, dass es oft breite Grundkonsense gibt – etwa beim Prinzip der Gleichwertigkeit – erschwert es, ein Gegenüber zum Feindbild zu machen. Denn Entmenschlichung funktioniert nur, wenn ich den anderen aus meiner eigenen Bezugsgruppe herausdefiniere. Sobald ich aber erkenne: Wir teilen zentrale Werte, auch wenn wir über Verfahren streiten – wird es schwerer, die Radikalisierungsspirale kommunikativ in Gang zu setzen.
Demokratie als Ideologie – der Kompass zurück zum Missstand
Ein zweiter positiver Nebeneffekt liegt darin, sich die Commitments immer wieder bewusst zu machen. Wenn wir das Borum-Modell linear denken – erst Missstand, dann Ungerechtigkeit, dann Ideologie – könnte man meinen: Ideologie tritt erst spät hinzu und befeuert externe Zuschreibungen. Doch genau hier wird Demokratie als Ideologie besonders wertvoll.
Denn Demokratie gründet auf einer Ideologie, die von der absoluten, unantastbaren Gleichwertigkeit aller Menschen ausgeht. Sie führt uns immer wieder zurück zum Missstand – und verhindert, dass Zuschreibungen ad hominem, qua Stereotyp oder kollektiver Abwertung erfolgen.
Stattdessen richtet sich demokratische Kritik an Verfahren:
- Funktionieren sie gerecht für alle?
- Oder benachteiligen sie bestimmte Gruppen?
- Wo endet individuelle Freiheit, weil sie die Freiheit anderer beschneidet?
Demokratie erinnert uns: Nicht jeder Kompromiss fühlt sich ideal an – aber entscheidend bleibt, ob er die Gleichwertigkeit wahrt.
Damit leistet Demokratie als Ideologie zweierlei:
- Sie schützt die rote Linie – Gleichwertigkeit darf nie zur Disposition stehen.
- Sie relativiert den Streit um Verfahren – der oft größer wirkt, als er ist.
Viele hitzige Debatten – von Regenbogenflaggen bis hin zum Gendern – suggerieren massiven Dissens. Doch fragt man direkt, wer für die grundsätzliche Schlechterbehandlung bestimmter Gruppen plädiert, bleibt die Zustimmung in aller Regel aus. Die Konflikte liegen also meist auf der Ebene der Verfahren, nicht beim Prinzip der Gleichwertigkeit.
Das soll nicht heißen, dass Ideologien der Ungleichwertigkeit verschwunden wären – im Gegenteil, die Mitte-Studien zeigen regelmäßig, dass sie fortbestehen in unserer Gesellschaft präsentsind. Aber der eigentliche Punkt liegt woanders: Schon Kommunikationsmuster im Alltag können dazu beitragen, dass sich Ungleichwertigkeit und Feindbilder normalisieren.
Wenn Diskussionen sich einseitig auf wahrgenommene oder konstruierte Ungerechtigkeiten verengen, wenn Gegensätze schärfer herausgestellt als Gemeinsamkeiten erinnert werden, dann geht schnell etwas verloren: die Fähigkeit, Missstände konstruktiv zu verhandeln.
Genau darin liegt die Gefahr – weniger im offenen Bekenntnis zu Abwertung, sondern in der schleichenden Verschiebung der Diskurskultur, die aus dem BORUM-Modell heraus verständlich wird: Resonanz verstärkt Feindbilder, Feindbilder erleichtern Entmenschlichung – und diese Logik kann sich auch in weite Teile der Gesellschaft hineintragen.
Fazit: Was uns Coyote Will über Radikalisierung und Demokratie lehrt
Am Anfang stand Coyote Will – der Lucky-Luke-Schurke, der ein Wort ohne klare Bedeutung so lange in Umlauf brachte, bis es alle benutzten. Sein „infam“ war leer, aber wirkungsmächtig. Genau so verhält es sich oft mit „Ideologie“ in heutigen Debatten: Ein Etikett, das diffamieren soll, statt zu klären.
In diesem zweiten Teil haben wir uns gefragt, wie Radikalisierungsprozesse tatsächlich funktionieren – und welche Rolle Ideologien darin spielen. Mit den Borum-Modellen haben wir ein Werkzeug genutzt, das zeigt:
- Radikalisierung beginnt nicht plötzlich, sondern dort, wo Missstände in Ungerechtigkeit resonieren.
- Ungerechtigkeit erzeugt Handlungsdruck – heute verstärkt durch Social Media, das Resonanzräume vervielfacht.
- Externe Zuschreibungen und Feindbilder folgen, ob real erlebt, instrumentalisiert oder konstruiert.
- Entmenschlichung zieht sich durch alle Phasen – nicht erst am Ende, sondern von Beginn an, wenn aus „die sind schuld“ ein kollektives „die sind minderwertig“ wird.
Das macht deutlich: Radikalisierung ist kein linearer Weg vom Nullpunkt zur Gewalt. Sie ist ein Mischpult aus Resonanzen, Zuschreibungen und Verstärkungen – analog wie digital. Und je mehr Filterblasen diese Dynamiken vermengen, desto schneller verschwimmt die Grenze zwischen Missstand, Ungerechtigkeit und Feindbild.
Hier wird das Gedankenexperiment aus Teil 1 wieder praktisch: Demokratie als Ideologie. Ihre Leitidee – die unantastbare Gleichwertigkeit – zwingt uns, immer wieder auf den Missstand zurückzukommen, statt Menschen oder Gruppen pauschal verantwortlich zu machen. Sie erlaubt, Verfahren zu kritisieren, ohne die Würde anderer infrage zu stellen. Und sie erinnert uns daran, dass wir in den großen Fragen oft viel näher beieinanderstehen, als es die Debatten um Symbole, Verfahren oder Sprache vermuten lassen.
Für die Prävention heißt das:
- Wir brauchen Sensibilität für Resonanz – Ungerechtigkeit muss nicht von allen gleich empfunden werden, bevor sie real ist.
- Wir müssen Feindbildlogiken früh hinterfragen, gerade wenn Sprache entmenschlicht.
- Und wir sollten die demokratische Leitidee als Ressource begreifen: Sie schützt den Kern, trennt Verfahren von Prinzipien und erschwert Entmenschlichung.
Coyote Will hat gezeigt, wie mächtig leere Begriffe sein können. In der Radikalisierungsprävention zeigt sich: Nur wenn wir Begriffe präzise fassen – und die Demokratie auch als Ideologie ernst nehmen –, können wir verhindern, dass Resonanz in Radikalität kippt und Sprache zu Gewaltbrücken wird.


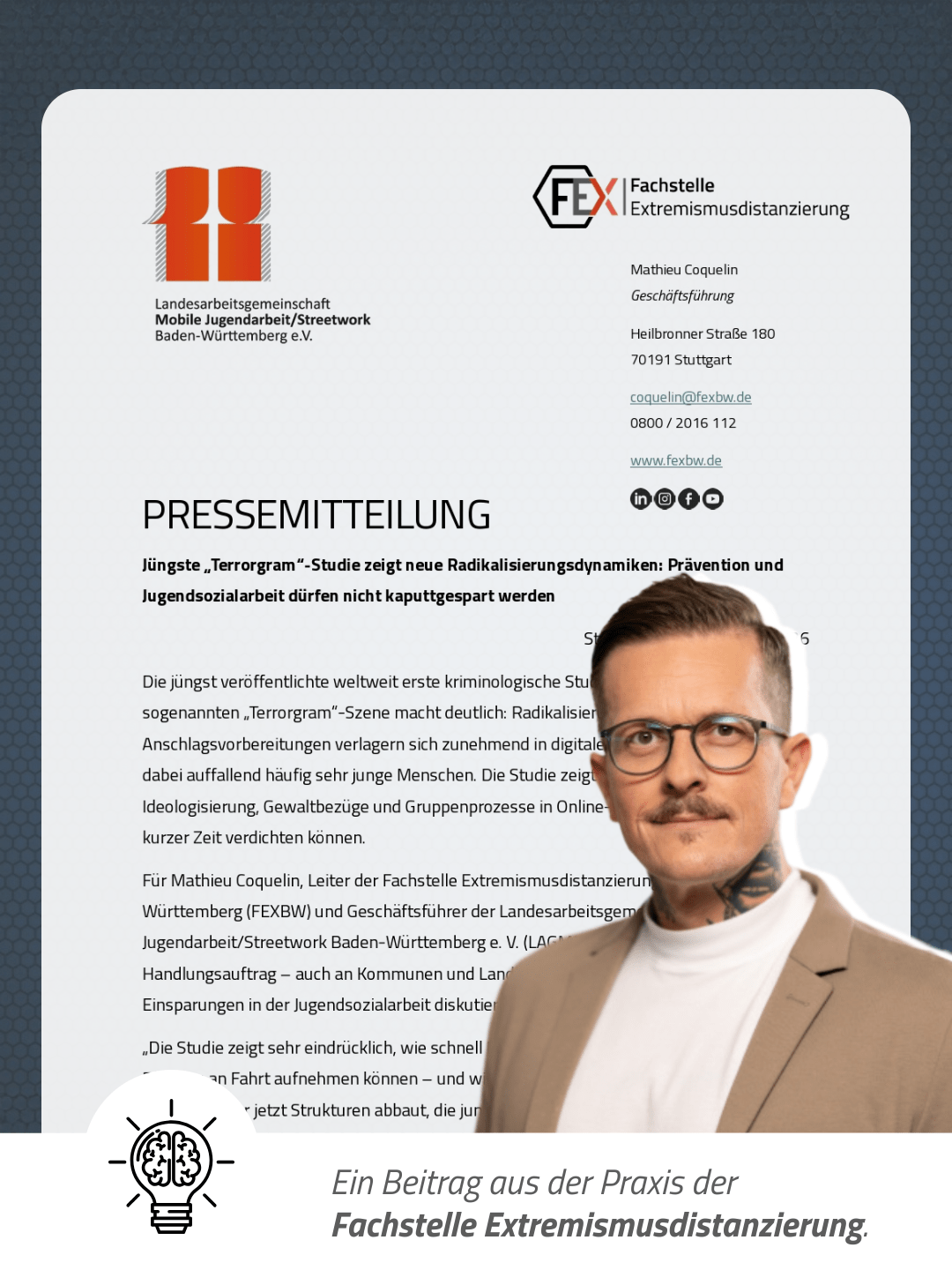
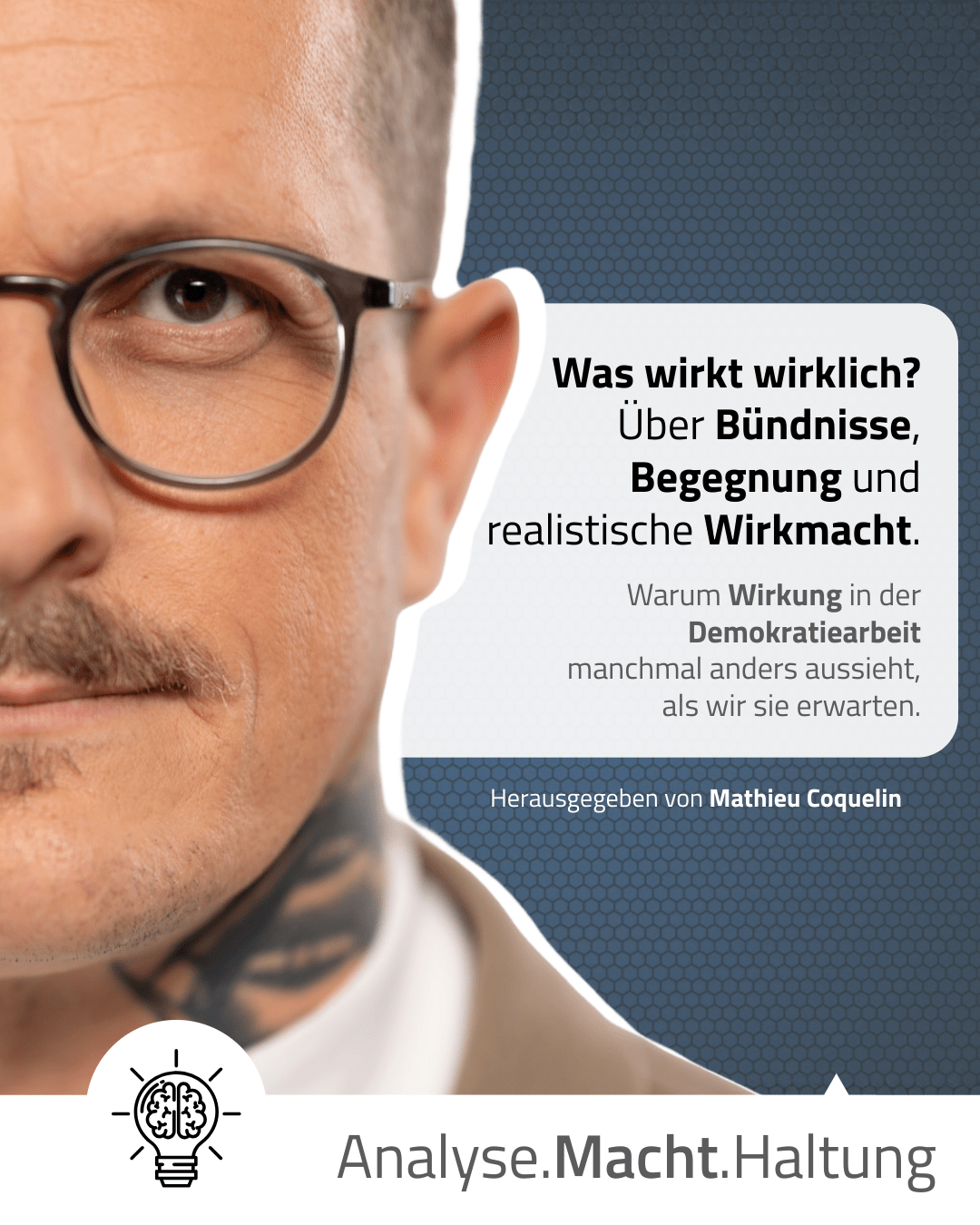
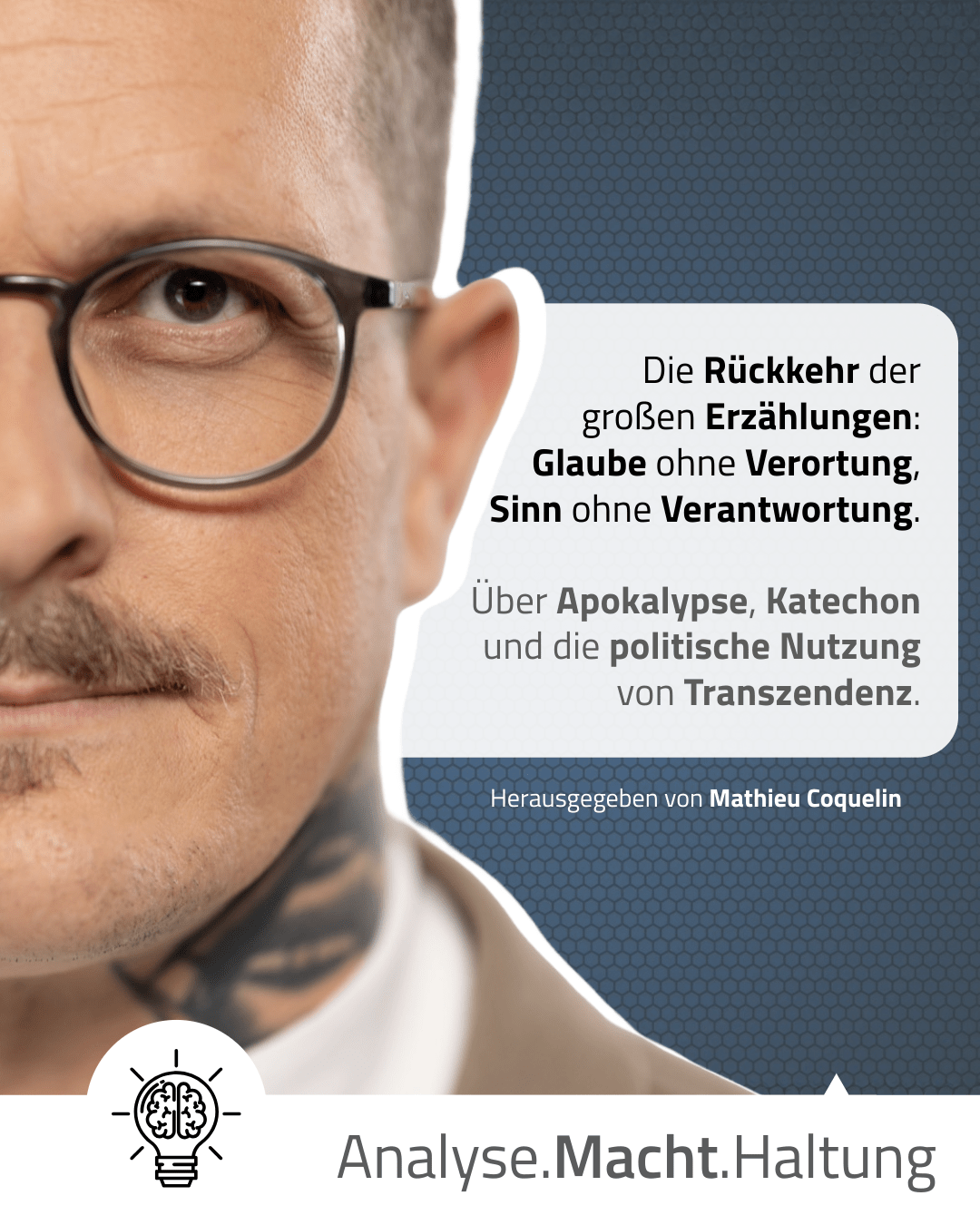
Schreibe einen Kommentar